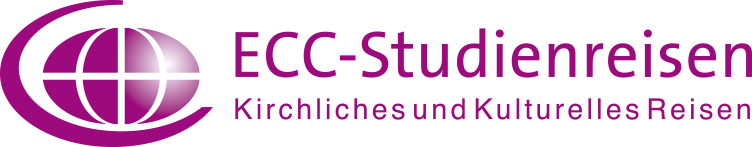Liebe Gäste!
Es ist bestimmt ein gewagtes Unternehmen, das Leben des kretischen Volkes darstellen zu wollen und zwar mit der Hoffnung, daß Sie dabei mehr verstehen als mißverstehen werden. Oswald Spengler hat ja die Auffassung vertreten, daß uns fremde Kulturen überhaupt verschlossen bleiben und nur derjenige in sie Einblick gewinnen kann, der über den von ihm sogenannten "physiognomischen Takt" verfügt, also über ein besonderes wie seltenes Charisma, die Welt fremder Zeiten und Menschen in ihrer ganzen Breite und Tiefe zu erkennen, zu erfassen und zu verstehen. Obwohl ich diese Meinung nicht uneingeschränkt teile, sollen folgende Ausführungen nur als eine erste Anleitung verstanden werden, als ein Wegweiser, der Ihnen helfen soll, dem kretischen Menschen leichter und tiefer zu begegnen.
Allerdings wird das Bild vom sozialen Leben auf Kreta, das ich zu zeigen versuchen will, gewiß kein vollkommenes und exaktes sein können, vor allem deshalb, weil sich das ganze Leben des Volkes in einem rasch sich vollziehenden Wandel befindet. Einzelbilder verändern sich, beginnen zu verblassen, ja bereits zu verschwinden und das Ganze ist nicht mehr vollkom men in seinem ursprünglichen Rahmen zu fixieren. Es entsteht oft der Eindruck, dieser soziale Wandel sei so rasch, daß das, was morgens noch Gültigkeit hatte, mittags bereits überholt ist. Daraus ergibt sich für Sie sicher unwillkürlich die Frage, ob das, was ich Ihnen jetzt erzähle, noch Gültigkeit hat, oder ob es nicht ein Traumbild aus alter Zeit ist. Ich würde sagen: beides! Mehr oder weniger können Sie alles heute noch in Kreta erleben und zugleich den Veränderungsprozeß leicht beobachten. Sie werden die Möglichkeit haben und sich glücklich schätzen, Lebendiges aus uralten Kulturen noch durch persönliche Erfahrung kennenzulernen. Und dann werden Sie selbst mehr aufspüren und entdecken, als ich Ihnen hier aufzeigen kann. Allerdings: Es gibt vielerlei Entdeckungen auf Kreta, z.B. die durch Ausgrabungen, denen Sie im Laufe eines Aufenthaltes begegnen; die schönste ist aber doch die Entdeckung des Menschen, die echte Begegnung mit ihm in der Ganzheit seiner Existenz!
Es ist natürlich evident, daß hier nur gewisse Aspekte des Volkslebens beleuchtet werden können, also nur einige der Grunddimensionen, die den Charakter des Vokes einst geprägt haben und heute noch entscheidend mitbestimmen. Drei dieser Dimensionen möchten wir hier näher betrachten: Die Dimension der Zeit, des Raumes und des Sakralen.
Die Dimension der Zeit
Die Zeit verstehe ich hier (vom anthropologischen Standpunkt aus) als den Rahmen menschlichen Seins, der über das individuelle Ich hinausgreift, und zwar dieses Individuelle nicht nur mit dem Real-Historischen, sondern über dieses hinaus sowohl mit dem Mythischen als auch mit dem Eschatologischen in Einklang bringt und somit die Fülle menschlicher Daseinsgestaltung und die Tiefe des menschlichen Bewußtseins umfaßt. Diese vielleicht ein wenig komplizierten Sätze will ich nun erläutern: Das Kind auf Kreta wird noch nicht primär durch Fernsehen und Radio erzogen. Die Welt, die es - durch die Eltern bzw. häufiger durch die Großeltern geführt - kennenlernt, ist die tatsächlich "sagenhafte" Welt, die, obwohl an sich nicht mehr lebendig, dennoch zum Lebensboden für dieses Kind wird. Nicht bloß hört man hier von dieser uralten Welt, man begegnet ihr auch. Bei seinen ersten Schritten stößt sozusagen das Kind auf Steine, die von dieser Welt überzeugend erzählen. Somit verbindet sich im Bewußtsein des Menschen der Mythos-Begriff keineswegs mit einer Wirklichkeitsleere - also mit jenem Raum, wo meist der Aberglaube und der Unglaube des modernen Menschen seine Behausung findet. Der Mensch ist bei uns nicht allein dem Sichtbaren geöffnet, und daher kann er viel mehr als nur "Reales" sehen und vernehmen! Durch diese ganz intensive Verbindung zur Vergangenheit erfährt die persönliche Existenz hier eine eigenartige Projektion bis in die Tiefe der Zeit. In dieser Tiefe spielt sich nur ein langes Drama ab. Gemeint ist der unaufhörliche Existenzkampf, den dieses Volk durch fast alle Jahrhunderte hindurch zu führen gehabt hat. Indem man nun beides miteinander verbindet, ist man durchaus berechtigt, von einer dramatischen Tiefe zu sprechen, die dem einzelnen als eine die Zeit umfassende Erfahrung vermacht und auf getragen wird. Diese Erfah rung ist die eigentliche Quelle für den geistigen Reichtum des V/olkes, der überall in der Struktur und in der Fülle des Lebens zum Ausdruck kommt: etwa in Sprichwörtern, im Scherz und Necken, in den verschiedensten Gebräuchen, am deutlichsten aber im hier noch lebendigen Volkslied und in den sogenannten Mantinades (jeweils zwei Verse mit je 15 Silben).
"Lebendig" bedeutet in diesem Zusammenhang spontan entstehendes und anonym weitertradiertes Volkslied bzw. Mandinada.
Wie reich diese Erfahrung den Menschen macht, kann man am besten feststellen, wenn man etwa einem Gespräch im Kaffeehaus beiwohnt, bei dem Freude und ein bißchen Wein die Musen zur Gesellschaft herbeigerufen haben bzw. während einer Taufe, einer Hochzeit oder eines anderen fröhlichen Ereignisses. In solcher Stimmung können die Kreter stundenlang singend miteinander über Tod und Leben, Lieben und Hoffen, über das Alltägliche, gleichwie über das Ewige sprechen, und zwar entweder so, indem sie alte Lieder oder Mantinades wiederholen, oder aus dem Stegreif neue nach der jeweiligen Situation oder Herausforderung selbst dichten. Diese Fertigkeit verdankt der kretische Mensch wohl zum größten Teil eben seiner oben genannten Erfahrung, einer Verdichtung der Weisheit von Generationen, die ihm als höchste Gabe des Lebens geschenkt und anvertraut wird.
Zeitliche Tiefe, Drama, Erfahrung sichern ferner dem Menschen hier eine feste Kontinuität. Trotz allem, was das Gegenteil hätte bewirken können, ja bewirken müssen, darf man hier tatsächlich von einer Kontinuität des menschlichen Seins sprechen. Tradition ist hier eine zwar im Laufe der Zeit wohl transformierte, jedoch niemals unterbrochene Kontinuität der biologischen, vor allem aber der geistigen, der gesamtkulturellen Wirklichkeit des Menschen. Nun, diese Wirklichkeit - das versteht sich von selbst - ist nicht nur ein Reichtum; sie kann zugleich auch eine Belastung für den Menschen sein, und zwar in zweifacher Hinsicht: Einerseits weiß er sich verantwortlich für diese Vergangenheit, deren geistiges Gewicht auf seinen Schultern lastet; zum anderen wirkt diese Vergangenheit mit solch einer normativen Strenge auf sein ganzes Leben, daß die Bindung mit seinem Erbe manchmal einer spürbaren Einschränkung der persönlichen Freiheit bzw. einem Opfer gleichkommt.
Man könnte in diesem Zusammenhang, obwohl das zu einem anderen Kapitel gehört, sagen, daß diese Dimension der Zeit nicht nur in Richtung der Vergangenheit verstanden wird, sondern auch der Zunkunft, wie ich bereits schon angedeutet habe. Vielleicht haben Sie inzwischen aus anderer Lektüre gelernt, daß in unserer Orthodoxen Kirche das Eschatologische, die Aussicht auf Vollendung bzw. auf die Fülle der Zeit nach der christlichen Verheißung besonders stark zum Ausdruck kommt. Der Mensch hat immer wieder Anlaß, diese Fülle der Zeit im Existentiellen Zusammenhang von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu erfahren und sich selbst in nerhalb dieses Ganzen zu verstehen. Nicht also der Moment, das Jetzt und Heute, ist des Menschen Existenzraum, sondern das Ganze, eben die Fülle der Zeit, von der aus Sinn oder Unsinn des Momentanen und Aktuellen be urteilt wird. Selbst im Gespräch mit einem einfachen Menschen können Sie Auffassungen hören, die zwar nicht eine philosophische oder theologische Spekulation über Sein und Zeit betreffen, aus denen jedoch unzweideutig das Erlebnis der Zeit in den hier dargestellten Dimensionen erkennbar wird.
Als zweite Dimension, die nötig ist zum Verständnis der Situation, möchte ich die Dimension des Raumes nennen. Kreta, als Insel, ist mit dem Begriff Raum in zweifacher Weise verbunden:
1. Zunächst einmal hat Bedeutung die Enge des Raumes, wie es mit jeder kleinen Insel der Fall ist; sie fühlt sich beengt, bedrängt von allen Seiten. Das ist eine bedrückende Tatsache, die sich ganz deutlich etwa im Leben des Dorfes abzeichnet. Heute ist das Problem allerdings nicht mehr so akut, weil viele Menschen das Land verlassen. Die Agrarbevölkerung ist in den letzten Jahren viel, viel weniger geworden. Aber früher, bis zum letzten Krieg oder noch später, war diese Enge des Raumes ein wirkliches Problem und verursachte immer wieder große Konflikte im Leben des Dorfes, der Gemeinden, der Provinzen. Es gab kein adäquates Verhältnis zwischen Raum und Menschenmenge, abgesehen natürlich davon, daß mit den damaligen Arbeitsverhältnissen und Mitteln die Landwirtschaft nicht intensiv, rationell und rentabel be trieben werden konnte. In diesem Zusammenhang ist die weitere Tatsache mit zu berücksichtigen, daß über sieben Jahrhunderte lang die Venezianer und anschließend die Türken das beste Land - und dessen größten Teil - für sich behielten, während die kretische Bevölkerung sich meistens auf die Bergdörfer und die unfruchtbaren Gebiete zurückziehen mußte. Dort hatte der Mensch praktisch lebenslang einen Existenzkampf an zwei Fronten zu führen: einerseits gegen die Eindringlinge (seine Tyrannen), zum anderen zur Verteidigung seines Vermögens, des kleinen Stück Landes, der Weide, des Wassers, der Ernte. Schon im alten Kreta gab es starke Konflikte dieser Art unter den Städten und den Provinzen, genauso wie heute Lokalinteressen die Menschen oft in Streit miteinander bringen.
Sie verstehen nun, wie stark solch eine permanente Spannung den Charakter des Menschen, sowie sein ganzes Leben, formt. Die Enge und der Konflikt drängt den Menschen hinaus in die Ferne. Zwei Dinge möchte ich in diesem Zusammenhang festhalten:
Die Auswanderung (von der anschließend die Rede sein wird) als Folge der Raumenge, also nicht als eine Folge der Vorliebe für das Leben in der Stadt oder in der Fremde, sondern vielmehr als die Folge eines gewissen Hasses auf die Lebensverhältnisse im eigenen Land.
Unter solch harten Lebensbedingungen wird der Mensch notgedrungenerweise wach, all seine Sinne und Begabungen werden aufs äußerste gespannt, verschärft und bestätigt. So ist z.B. der Bildungsdrang zu verstehen, der für Kreta bezeichnend ist - wie überhaupt die Wach samkeit des Menschen.
2. Auf der anderen Seite ist aber die Breite des Raumes gegeben. Eine Insel ist nach allen Seiten hin offen, hat einen weiteren Horizont. Es ist die See, das offene Meer, das für die soziale Situation in Kreta von besonderer Bedeutung ist. Sie kennen die Rolle des Meeres im alten kretischen Reich. Sie Wissen, wie sehr die geographische Lage der Inselmitten im Mittelmeer ihr Schicksal mitbestimmt hat. Das Meer aber bleibt vor allem der Weg zur Auswanderung, die ständige Herausforderung, hinauszugehen. Das prägt zum guten Teil das Leben und ermutigt zur Auswanderung. Der einzelne und die Familie leben in der Situation der Wanderung, zumal wenn ein Glied der Familie schon im Ausland ist, weil dann die ganze Familie seelisch mit ihm wandert! Zahlreiche Kreter arbeiten auf Handelsschiffen, . andere haben sich in den USA, Kanada, Australien, Afrika und Westeuropa niedergelassen, wo sie ein bewundernswertes Gemeinschaftsleben führen. Alle diese Diaspora-Kreter fühlen sich stets mit der Heimat verbunden und nehmen auch auf vielfache Weise am Leben der Insel teil. Von einer inbrünstigen Nostalgie beseelt, kommen sie immer wieder nach Hause; sie leben mit dem Traum, auf Kreta zu sterben! Dazu eines der Volkslieder:
"Mein Schicksal, ich bitte dich, schick' mich nicht in die Fremde.
Und wenn du mich doch dahin schickst, lasse mich nicht dort sterben.
Ich sah denn, wie begraben wird der Fremde in der Fremde:
ohn* eine Kerze und Weihrauch, ohn' Diakon und Priester
und von der Kirche weit entfernt!"
Dieses ständige Hinausgehen und Zurückkommen beeinflußt freilich positiv wie negativ das Leben des Menschen.
Auch prägt der Raum hier noch eine andere Eigenschaft des kretischen Charakters, die ich als "Ökumenizität" bezeichnen möchte. Es gibt auf Kreta ganz wenige Dörfer, die irgendwo in einer Schlucht verloren liegen. Meist stehen sie auf Hügeln, schmiegen sich an Bergseiten oder thronen auf Höhen, von wo aus man einen offenen Horizont hat und weit blicken kann. Im Zusammenhang mit der Auswanderung und mit der Tatsache, daß Kreta - als eine Brücke - durch die Geschichte hindurch ein Ort der Begegnung von Völkern und Kulturen gewesen ist, prägt im Menschen eine ökumenische Gesinnung und Bereitschaft. Wir denken natürlich hier nicht - oder nicht primär - an die Ökumene im theologisch-kirchlichen Sinne. Gemeint ist die Grundeinstellung des Menschen gegenüber der Außenwelt. Der Mensch zeigt hier ein reges Interesse für das, was außerhalb seiner eigenen Existenz geschieht. Wenn Sie in einem Kaffeehaus sitzen, oder überhaupt in Gesellschaft mit kretischen Menschen sind, haben Sie bald den Eindruck, daß es zwischen Ihnen und Ihren Gesprächspartnern überhaupt keine Geheimnisse mehr gibt, ja vielmehr, daß alles, was überall in der Welt geschieht, ein Geschehen im eigenen Dorf ist. Wie im alten Hellas - so auch heute - ist der häufigste Gruß nicht etwa "guten Morgen" oder "guten Tag" sondern "ti nea?" oder "inta hambaria?". Beides heißt: "Was gibt's Neues?" Diese Neugier, die permanente Neugier des Griechen, kann man sagen, ist bezeichnend für seinen Charakter, wie sie zugleich ein Faktor für die Förderung der wissenschaftlichen Erkenntnis, des Forschens, des Suchens nach dem Neuen ist. Also auch im täglichen Geschehen bleibt man nicht in sich verschlossen, sondern man kommuniziert mit der ganzen Welt, indem man eben danach trachtet, den gesamten Lebensprozeß mit zu verfolgen.
Eine dritte und letzte Dimension, die ich in diesem Zusammenhang erwähnen möchte, ist die Dimension des Sakralen. Sie wissen, daß der Hellenismus von alter'sher dem orientalischen Mystizismus die griechische Nüchternheit entgegenstellt und versucht hat, den Menschen von den Mächten der Dunkelheit und des Chaos zu befreien. Aber das ist nicht immer ganz gelungen, zu mal ja Auseinandersetzung zugleich Kommunikation bedeutet, also gegenseitige Einwirkung, positive wie negative. Der Mensch trägt somit in sich gleichzeitig das Apollinische und das Dionysische, das Helle und das Triebhafte. In der christlichen Terminologie sagen wir: den alten und den neuen Adam! In Kreta sind nun alle Kontraste vielleicht etwas deutlicher als sonstwo. Wer Kazantzakis gelesen hat, wird diese Antithese, diese Spannung im Charakter und im Leben des Volkes leichter erkennen. Kazantzakis selbst spricht ja von dem "kretischen Blick", von einer besonderen Art, sich selbst und die Welt zu sehen und zu verstehen; diese Art liegt in der äußersten Aufforderung zum Kampf dafür, daß die Materie zum Geiste, der Wurm zum Schmetterling transfiguriert wird, das Fleisch zur Flamme, wie die Gemälde des anderen großen Kreters, EL GRECO, darstellen.
Das Überleben von sehr alten Vorstellungen aus der Welt des Mythischen, des Dämonischen wie des Heiligen, bilden einen zentralen Aspekt der sakralen Dimension. Ich will nicht sagen, daß das Volk in Kreta in besonderer Weise abergläubisch sei. Jedes Volk ist zwar in gewisser Weise abergläubisch, und je weniger gläubig, desto mehr abergläubisch natürlich. (Und der moderne Mensch, der sich als weniger gläubig gibt, lebt gewiß in einem immer größeren Aberglauben.) Aber die Fülle' der Sagen, der Mythen und überhaupt des überlieferten Gutes ist hier noch so stark und so lebendig, daß das Real-Profane es nicht vermag, die ganze Aufmerksamkeit des Menschen auf sich zu beschränken. Man kann sagen: Der Positivismus und Pragmatismus hat den Menschen hier noch nicht so stark seiner Herrschaft unterwor fen, daß er für das Metaphysische verschlossen bliebe. Das Gegenteil ist eher der Fall. In diesem Zusammenhang haben wir natürlich auch die Rolle des Christentums zu berücksichtigen. Der Einfluß des Christentums auf das persönliche und das soziale Leben ist so Stark, daß wir berechtigt sind, von einem liturgischen Selbst- und Weltbewußtsein des Menschen zu sprechen; "liturgisch" insofern, als alles, Persönliches und Überpersönliches, Lokales und Kosmisches, in einem größeren Zusammenhang verstanden wird. So wird der Kosmos als der Raum, die Zeit als der Verlauf der Liturgie Gottes gedeutet. Damit wird einzelnen ein Existenzsinn gerade von diesem liturgischen Zentrum her gegeben. Das Ende der Liturgie ist die Vervollkommnung des Ganzen, eben die Metamorphosis, die Transfiguration zum Geiste, die "Vergottung", wie ein Zentralbegriff griechisch-orthodoxer Theologie besagt. Dies bedeutet eine Sinngebung von Eschaton her, deshalb die eschatologische Grundhaltung des Menschen, von der ich eben schon ge sprochen habe. Denken Sie nun nicht, ich wollte behaupten, der kretische Mensch sei deshalb etwa "frommer" als die anderen, oder ein "besserer" Mensch. Nur eins soll aus diesen Ausführungen hervorgehoben sein: daß dieser Mensch eben dem "Metaphysischen" gegenüber vielleicht noch empfindlicher und offener ist als der moderne Mensch der nackten "Tatsachen". Im täglichen Leben, in der Denk- und Verhaltensweise spielt solche Einstellung natürlich eine eminente Rolle.
Ich darf versuchen, dieses Phänomen von einem anderen Aspekt her zu beleuchten. Die zentrale Lehre von der Inkarnation Christi wird in der orthodoxen Welt in besonderer Weise erlebt. Wir wissen: Christus, der Logos, "ward Fleisch und nahm Wohnung unter uns". Damit ist das, was wir bis jetzt als "metaphysisch" bezeichnet haben, nun in eine Nähe getreten - eine Nähe, die der Mensch hier sehr stark empfindet. In diesem Sinne können wir z.B. von einer Volkstümlichkeit der Kirche sprechen. In allen Formen und in allen Arten merkt man diese Volkstümlichkeit. Wenn man zwar einen Bischof in vollem Ornat zelebrieren sieht, hat man den Eindruck, das wäre eine viel zu weite, fremde Welt. In Wirklichkeit stimmt dies aber für den einzelnen hier gar nicht. Sowohl in der Struktur des Kultus und der Kirche überhaupt, als auch im persönlichen spirituellen Leben spürt man diese Nähe deutlich. Wenn Sie einen Gottesdienst besuchen, wird Ihnen auffallen, daß wir keinen Raum haben, der so "heilig" wäre, daß der Mensch sich in diesem so fremd und überwältigt fühlte, daß er sich in voller Disziplin und Form verhält. Man fühlt sich "zu Hause”, geht raus und kommt wieder, spricht und läßt die Kinder herumlaufen und laut weinen oder lachen. Das wird noch deutlicher, wenn Sie eine Taufe erleben oder zu einem "Pańigiri", einem Heiligenfest im Dorf, gehen. Man kennt eben die Kirche als den Ort, wohin der Mensch in seiner ganzen Wirklichkeit geht, also nicht als ein halber oder ein in sonntäglichen Formen getarnter "Frommer". Man kann das ein bißchen erweitern und sagen: Selbst in der Form und in der Gestaltung des Raumes ist diese Nähe. Die architektonische Form ist bekanntlich die Frucht einer Idee. Welche Idee herrscht in der Architektur der orthodoxen Kirchen? Ich weiß nicht, was sich der Meister des Kölner Domes gedacht hat, als er diesen großartigen Bau plante. Sobald ein orthodoxer Mensch aber diesen herrlichen Dom betritt, fühlt er sich von seiner Größe so total überwältigt, daß seine Person gewiß erhaben, doch zugleich entmachtet, nivelliert wird. Wenn man dagegen den großen Dom der östlichen Christenheit, die Hagia Sophia in Konstantinopel, betritt, fühlt man sogleich das Erhabene so nahe, den Himmel so handgreiflich, das Licht und alles so freundlich, daß hier gleich das Gefühl der Koinonia vermittelt wird, der Gemeinschaft mit dem "Metaphysischen", die Zuversicht vom Angenommensein und von der Würde der menschlichen Person. Dieses Gefühl ist natür lich noch stärker in einer kleinen Dorfkapelle.
Die genannten drei Dimensionen mögen Ihnen das Verständnis nicht nur für die Vergangenheit, sondern auch für die gegenwärtige Situation unseres Volkes erleichtern. Mit der Dimension des historischen Dramas im Hintergrund wird die Spannung im Gemüt des heutigen Kreters offenbart, der - trotz seiner in der Geschichte der Menschheit geradezu einmaligen Opfer für die Freiheit - heute wieder im Spiel der inneren und der weltpolitischen Konstellationen den Raum seiner Freiheit bedroht sehen muß. Öder: Was bedeutet das fast plötzliche Einbrechen der Industrialisierung, der Verstädterung, des Tourismus, überhaupt der "Moderne" für ein Volk, in dessen Leben die Tradition, die Normen und die bisweilen konstanten Werte eine so große Bedeutung gehabt haben?
Nun darf ich Ihnen schnell einige mehr konkrete Aspekte des sozialen Lebens aufzeigen, ohne natürlich diese ausführlich, geschweige denn das genze Leben erfassen zu können.
Zunächst das Dorf, die Gemeinde und die Gemeinschaft. Es sind dies Grundbegriffe für das Verständnis des Lebens auf Kreta. Zunächst zum Dorf in der Form wie Sie es sehen, obwohl es heute nicht mehr dem älteren gläichzusetzen ist. Das wichtigste Element im Leben des Dorfes ist ein starkes Gemeinschafts- und Solidaritätsgefühl. Ich habe vorher über die Enge des Raumes und über die dadurch entstehenden Konflikte gesprochen. Trotz die ser Konflikte - man hat gelernt, mit Konflikten zu leben! - und trotz all der Schwächen einer kleinen Menschengruppe, wundert man sich über die Fülle und die Intensität menschlicher Solidarität und Brüderlichkeit. Dieses fast österliche Bild einer lebendigen Gemeinschaft war natürlich viel ausgeprägter in der Zeit der Versklavung. Die Solidarität unter den Christen war damals die einzige sichere Waffe im Kampf um die eigene Existenz. Aber auch in der Gestaltung des Lebens überhaupt, in der Arbeitsteilung, in Not und Freude, steht der Mensch des Dorfes niemals allein; er fühlt sich niemals verlassen. Diese Gemeinschaft zeigt sicher immer noch im sozialen Leben des Volkes hier in ganz verschiedenen Formen, die oft mit der reinen Logik nicht zu begreifen sind. Sie zeigt sich in einer regen Teilnahme am Leben des anderen. Einem Griechen ist z.B. das Schweigen in einer westeuropäischen Eisenbahn völlig unverständlich. Um dort zu einem Gespräch zu kommen, muß man vielleicht einige hundert Kilometer zurücklegen, und meist schafft man es trotzdem immer noch nicht. Begegnen Sie dagegen hier im Bus, im Kaffeehaus oder gar auf der Straße einem Men schen, dann werden bald solche Fragen laut, wie: "Wie heißen Sie? Sind Sie verheiratet? Wieviele Kinder haben Sie? Welchen Beruf üben Sie aus? " Wieviel verdienen Sie?" Innerhalb einer halben Stunde kennt man sich. Sicherlich ist das Neugier - manchmal eine sehr lästige! Aber da ist etwas mehr: ein Verlangen, am Leben des anderen teilzunehmen. Dies gilt übrigens nicht nur für das Dorf, sondern ebenso auch für die Stadtbevölkerung. In gleicher Art sind die Grundmomente des Lebens keine privaten Situationen, sondern Gemeinschaftsereignisse: Geburt, Taufe, Hochzeit, Auswanderung und Rückkehr, Tod. Wenn eine Frau hier schwanger ist, steht sie im Mittelpunkt des Lebens des Dorfes, und jeder diskutiert über diesen Zustand, manchmal in sehr scherzhafter Weise. Man diskutiert über den Mann, über die Frau, über die ganze Entwicklung. Man macht also Spaß, Bemerkungen, und Prophezeiungen vor allem. Was wird es sein? Ein Kna be - ein Mädchen - beides (Zwillinge)? Trotz all' dem wünscht man "gute Befreiung". Wenn das Kind geboren wird, gibt es im Dorf ein Fest, an dem alle spontan teilnehmen. Wohlbemerkt, es ist viel leichter, an der Trauer des anderen, an dem Schmerz teilzunehmen, als an seiner Freude, sogar in einer Gesellschaft, wo das tägliche Leben viel Ärger mit sich bringt und wo die Menschen mit - oder gegeneinander im Wettkampf stehen!
Die "kretische Hochzeit" ist in Griechenland bekannt als etwas ganz Beson deres, Eigentümliches, Großartiges. Das Zeremoniell kann ich hier nicht im einzelnen darstellen. Eine Hochzeit dauerte früher eine ganze Woche, manchmal sogar noch länger. Sie können sich vorstellen, wie viele Sitten und Gebräuche hier die Zeit füllten. Heute ist dies alles natürlich (leider!) viel, einfacher geworden. Jedoch selbst bei der kleinsten Hochzeit sind noch wenigstens 200 - 300 Menschen anwesend. Wenn die Trauung am Sonntag stattfindet, kommen sie schon oft am Samstag, manche sogar am Freitag und gehen erst am Montag oder Dienstag weg. Diese Menschen müssen natürlich irgendwie verpflegt werden, irgendwo Unterkommen. Sie schlafen meistens schlecht, essen dafür um so besser! Sicher ist, daß sie alle viel trinken! Aber das alles geschieht nicht auf Kosten des Bräutigams; alle sind sie Gäste des ganzen Dorfes. Denn wenn einer Hochzeit hat, dann haben alle Hochzeit!
Ein anderes Bild: die Geschenke. Nach der Trauung steht der Priester mit dem "Evangelium" neben dem neuen Paar. Man bekreuzigt sich, küßt das Evangelium, dann den Bräutigam, wenn man will auch die Braut - man darf es! - und sagt ihnen einen Wunsch. Der "Koumbaros", der Trauzeuge, verteilt kleine weiße Zuckermandeln (Symbole der Reinheit). Neben ihm steht ein Verwandter mit einem Tablett, worauf man einen Geldschein legt. Die Summe, die auf diese Weise gesammelt wird, hilft dem neuen Paar, die Hochzeitskosten zu decken, meistens bleibt noch etwas für einen guten Start. Das waren nur zwei der vielen Gemeinschafts- und Solidaritätsbilder, wie wir sie nicht nur bei einer Hochzeit, sondern auch bei vielen anderen "Stationen" des Lebens finden.
Bleiben wir einen Moment bei der letzten Station menschlicher Existenz.
Der Tod eines Menschen bewegt die ganze Gemeinde. Um die Bedeutung des Todes richtig zu verstehen, müßten wir aber zuvor ein Wort darüber sagen, wie hier das Leben erfahren wird. Denn wenn z.B. der Tod eine zentrale Stelle in der kretischen Volkspoesie innehat, so erklärt sich das wohl hauptsächlich als Protest und Klage über den Verlust des Lebens, dem das eigentliche Pathos des Kreters gilt. Die harte, dorische Seele der kämpferischen Natur des Menschen hier offenbart sich angesichts des Todes von dionysisch, ja epikureisch anmutenden Zügen beherrscht:
"Was habt ihr alle rundherum und ist euer Herz schwermütig?
Warum eßt ihr und trinkt ihr nicht, warum seid ihr nicht fröhlich,
bevor der Charos (Tod) zu uns kommt, um uns auszuplündern..."
Der Protest richtet sich in einer Mantinada gegen Gott selbst:
"Gott ist ungerecht, ich kann es beweisen:
Er giebt uns ein Leben und nimmt es wieder!"
Daher die Klage der "Desperados":
"Da es den Tod gibt und der Körper sich auflösen wird,
was nützt das Leben, wäre es auch doppelt so lang!"
Es gibt natürlich auch die Gegenerfahrung:
"Erlebst Du nur eine Morgenröte, so hast Du doch genug gelebt.
Eine Rose, die lang blüht, verliert den Duft!"
Doch auch hier geht es um Leben, und zwar um ein volles Leben, ja um die Lebensqualität, wie man vielleicht modern sagen würde.
Wir werden gleich nachstehend von dem Erlebnis der Unsterblichkeit, gerade angesichts des Todes, sprechen. Diese Unsterblichkeit wird allerdings in der Endgültigkeit der Trennung von "dieser Welt" erfahren:
"Die Erde hat der Herr gemacht, er hat geschmückt den Kosmos.
Drei Dinge hat der Herr jedoch nicht in der Welt geschaffen:
Es gibt nicht Brücken über's Meer und Rückkehr aus dem Hades
und Treppen zu dem Himmel hin, hinauf-, hinabzusteigen!
Daher:
Hört zu, was ein junger Mann bestellte aus dem Hades:
Freut euch, ihr Lebendigen, auf der Welt da oben;
denn hier unten, wo wir sind, ist viel zu eng der Raum.
Hier gibt es keine Kneipen, keine Charokopoi (Lebenslustige)
und keine Zielscheiben, worauf die Männer schießen.
Hier gibt es nur noch Lehm und Schlamm, wo soll man Kugel werfen!"
(Kugelstoßen = auf Kreta beliebter Wettkampf, bei dem man. Stein- bzw. Eisenkugeln möglichst weit zu stoßen versucht.)
Dennoch: Der Kreter weiß mit Kazantzakis, daß zwar "Früchte und Frauen große Freuden sind", daß aber der Sinn des Lebens nur bei den großen Ideen zu suchen ist. Als solche gelten hier z.B. die Güte.
(eine Mantinada: "Reichtum und Schönheit vergehen,
die Jugend verblüht,
allein ein gutes Herz wird ewig dominieren!”)
die Freundschaft, das Ehrgefühl, die Tapferkeit, die Vaterlandsliebe, die Freiheit. Das sind Existentialkategorien, die den eigentlichen Inhalt
eines wahrhaft menschenwürdigen Lebens bestimmen. Und deshalb hat jede von ihnen einen Wert, der höher steht als das Leben selbst. Das ist keine bloß theoretische Lebensphilosophie und akademische Wertethik; das ist ein Kanon des Lebens, wonach man sich zu richten hat. Nicht selten wird Menschenleben gerade solchen Kategorien geopfert bzw. hingegeben, etwa bei der Verletzung des persönlichen oder des familiären Ehrgefühls, während es zur Selbstverständlichkeit für jeden gehört, das Leben im Kampf um die Freiheit bereitwillig einzusetzen. Die Parole "Freiheit oder Tod" war ja jahrhundertelang fast die einzige Alternative für den Menschen auf dieser Insel.
Indem der Kreter also am Abgrund entlang und stets todbereit leben muß, bleibt doch der Tod ein erschütterndes Ereignis, das die ganze Gemeinde in Bewegung setzt. Verkündet wird er durch das eigenartige Läuten der Glocke. Gleich hört alle Arbeit auf und die Menschen aus dem Dorf und der Umgebung versammeln sich im Hause des Verstorbenen, wo sie bis zur Beerdi gung meistens am nächsten Tag, bleiben. Da sind die Männer, die, weil es meistens nicht genügend Raum im Hause gibt, sich irgendwo draußen setzen. Sie sprechen zunächst einmal über den Verstorbenen, dann aber geht das Gespräch ins tägliche Leben, meistens ins Politische über. Aber jedenfalls:
sie sind dabei - die ganze Nacht hindurch. Niemand darf eigentlich schlafen. Die Frauen bleiben innerhalb des Hauses. Sie setzen sich im Kreise um den Verstorbenen und beweinen ihn. Die "Moirologie", die kretischen Klagelieder, sind nach Klang und Inhalt etwas ganz Ergreifendes. Die Mädchen üben sich oft in Gruppen oder auch alleine zu Hause oder auf dem Felde, indem sie sich den einen oder anderen - noch Lebenden - als Verstorbenen vorstellen. Es sind meist Lobausdrücke für den Verstorbenen, Erzählungen aus seinem Leben; dies alles wiederum in Versen, die die Frauen in diesem Augenblick spontan bilden. Die Melodie ist verbunden mit einer bestimmten rhythmischen Bewegung des Körpers. Innerhalb dieser Bewegung soll der Vers gesungen werden, und zwar in einem Sinnzusammenhang der verschiedenen Verse. Jede Frau singt zunächst etwas für den Verstorbenen; dann geht sie aber bald dazu über, ihre eignen Toten zu beweinen. Obwohl somit jede Frau etwas Anderes singt, sind sie alle im Rhythmus als ein Chor vereint. Es kommt vor, daß die Frauen manchmal dabei auch manches Dumme erzählen, was eine gewisse Heiterkeit verursachen kann. Im ganzen gesehen sind es aber Momente, in denen sie eine reiche poetische Begabung aufweisen, eine oft tiefsinnige Reflexion.
In diesen Situationen merkt man am deutlichsten, was ich vorhin ausdrücken wollte: die Nähe, die Unmittelbarkeit zwischen dem Hier und dem Jenseits im Glauben des Volkes. Man merkt hier, gerade vor der nacktesten und fürchterlichen Realität des Todes, was Auferstehung und Unsterblichkeitsglaube bedeutet. Lebende und Tote treten in eine unglaublich lebendige Gemeinschaft miteinander. Man kann sagen, der Tod ist eine exzellente Gelegenheit überzeitlicher Kommunikation der Menschen. Man bestellt z.B. durch den Verstorbenen Grüße'an die eigenen. Er soll denen, die da "unten" sind, über alles berichten, was hier in der "oberen Welt" geschieht - ein Motiv übrigens, das sehr häufig auch in unseren Volksliedern vorkommt. Man bittet ihn, dies und jenes zu sagen. Sogar hört man oft "Sing ihm nicht die ganze Wahrheit, etwa daß es mir schlecht geht; sag ihm, es ist alles in Ordnung, das Vieh, das Land; die Bäume blühen; es fließt das Wasser..."; also die Vorsicht, daß man dem Verstorbenen nicht weh tut mit einem "sachlichen Bericht". Aber manchmal geschieht auch das Gegenteil - was vom Standpunkt der sozialen Kontrolle her gesehen hoch interessant ist: indem etwa eine Witwe dem Verstorbenen den Auftrag gibt, ihrem Mann zu erzählen, wie sehr sie von seinen Angehörigen mißhandelt wird. Sie leitet somit zwar mittelbar, jedoch mit Erfolg, einen Prozeß der sozialen Kontrolle ein. Niemand kann sie tadeln dafür, daß sie im Moment des Schmerzes eine unangenehme Situation bekanntgegeben hat. Die Angehörigen müssen nun die daraus folgende Kritik der Gesellschaft ernstnehmen. Diese Zwischenbemer kung sollte uns natürlich nicht vom Hauptthema ablenken, daß nämlich das Leiden des einen Leiden der ganzen Gemeinde ist.
Kaffeehaus und Kirchplatz sind zwei der markantesten Orte, wo hier auf Kreta Gemeinschaft verwirklicht wird. Vom Kaffeehaus brauche ich nicht
viel zu erzählen. Sie werden es selbst entdecken und kennenlernen. Es ist immer, von der Zeit der alten "Agora" der Athener bis heute, der Ort der zwischenmenschlichen Begegnung und die große Schule der Nation! Groß war und bleibt auch immer noch die Bedeutung des Kirchhofs, also des Platzes um die Kirche. Nach dem Gottesdienst bleiben dort die Menschen noch etwas zusammen und besprechen - in der durch die Liturgie geschaffenen geistigen Atmosphäre - verschiedene Probleme ihres Lebens. Oft sind hier schwerwiegende Entscheidungen getroffen worden, so daß man mit Recht den Kirchhof als das eigentliche Parlament des griechischen Volkes bezeichnet hat.
Diese Bilder sollen natürlich keineswegs die Gesamtsituation idealisieren. Es gibt auch viele Formen von menschlichem Egoismus, der die Gemeinschaft nicht gerade fördert, sondern eher zerstört. Gerade vom Gesichtspunkt der Gemeinschaft und der Solidarität aus kann man die große Umwälzung beobachten, die in allen Lebensbereichen als moderner Individualismus auftaucht - egoistisch, selbststüchtig, die alten Formen zerstörend. Z.B. hatte bis vor kurzem jede Familie auf dem Lande nur einen Ochsen oder eine Kuh; damit also weniger Arbeit und weniger Belastung, was die Haltung des Viehs anbelangt. Im Winter arbeitete diese Familie mit einer anderen zusammen, und sie pflügten mit ihren beiden Tieren das Land und halfen sich gegenseitig, was viel rentabler war. Heute will jeder seinen eigenen Traktor haben, den er nur für ganz kurze Zeit wirklich verwendet. Technisch noch unerfahren, läßt er das Gerät bald verrosten. Sie verstehen, daß überhaupt der Umschlag von der Gemeinschaft zum Individualismus eine sinnvolle Zusammenarbeit (etwa Genossenschaften, gemeinsame Aktionen u.s.w.) oft sehr schwierig macht. Gerade hier bemüht sich die Orthodoxe Akademie mit besonderer Intensität. Sie verstehen ferner, was die Auflösung der Gemeinschaft für eine Kirche wie unsere bedeutet, die als "Kirche des Johanneischen Christentums", d.h. unter anderem als ."Kirche'der Gemeinschaft" bekannt ist.
Auch die kleineren Gemeinschaftsformen - Familie und Verwandtschaft - befinden sich heute in einem Prozeß der Wandlung. Wir haben in Griechenland noch eine ziemlich starke Familie, sogar noch eine lebendige Großfamilie. Hierbei spielt die Blutsverwandtschaft eine große Rolle. In gewisser Weise haben wir noch einen Patriarchalismus mit allen Formen der Autorität, mit allen Befugnissen und mit der ganzen Verantwortung. Hier hat das Wort "Vater" ein fast "jahwistisch" anmutendes Gewicht. Im ganzen gesehen lebt hier die Familie noch in dieser Solidarität und gegenseitigen Verantwortung. Z.B. sind die Eltern verantwortlich für das Leben der Kinder, bis sie selbstständig ihren eigenen Weg gehen können. Aber auch die Kinder haben eine Verantwortung gegenüber ihren Eltern. In den Augen der Gesellschaft ist es eine gewisse Erniedrigung, wenn Kinder ihre Eltern in ein Altersheim schicken. Es gibt Altersheime, aber eigentlich nur für extreme Fälle, für Notfälle.
Ferner ist die Familie für die sogenannte "apokatastasis" der Töchter verantwortlich. Gemeint ist die Verheiratung, und noch präziser: die Aussteuer, die Mitgift, die bei uns noch unerschüttert als Bestandteil der Gesellschaftsstruktur weiterbesteht. Das heißt also: Wenn das Mädchen heiratet, muß es etwas bekommen. Dieses "Etwas" ist oft der Anteil am Land, und zwar manchmal etwas mehr als der gerechte Anteil, je nach den sonstigen Qualitäten der Tochter. Es wird dabei ein bißchen ausgehandelt! - vor allem, wenn noch nach alter Weise die Ehe geschlossen wird, nämlich nach Vermittlung und Vereinbarung. Das Mädchen hatte früher von klein auf zu lernen: "Wenn es meine Eltern wollen, will ich es auch!" Diese Tradition ist noch in Kraft, manchmal sogar so uneingeschränkt, daß kleine Mädchen im Alter von 14 Jahren oder noch jünger allein durch Entscheidung der Eltern verlobtwer den. Wir kennen sogar den besonders begabten Typus von Männern oder Frauen, die bei solchen Vermittlungen und Verhandlungen das ganze sehr geschickt in die Wege leiten. Auf dem Spiel steht allerdings die Mitgift, wenn die jungen Leute alleine die Entscheidung treffen, was mehr und mehr der Fall ist. Hier kann die Familie zunächst zustimmen, ohne eine finanzielle Bindung einzugehen. Später wird natürlich meistens auch dieser Punkt geregelt.
Vor allem fühlt sich aber die Familie für die Zukunft ihrer weiblichen Glieder verantwortlich. Kaum ist heute die alte Sitte eingeschränkt, wonach der Bruder nicht heiraten darf, bevor nicht alle seine Schwestern verheiratet sind, auch wenn er der älteste in der Familie ist. Entgegengesetztes Handeln würde sich für ihn nachteilig auswirken bei der Wahl seiner eigenen Frau. Denn man sagt: Wenn du ein solches Familienbewußtsein hast, will ich dir meine Tochter nicht anvertrauen. Es ist also keine einfache Sache, wenn man eine oder gar mehrere Schwestern hat. Ein Vetter von mir hatt 11, war der älteste, und er wartete, bis alle verheiratet waren!
Im Jahre 1961, glaube ich, hatte ich eine Artikel in einer deutschen Zeitung veröffentlicht, der damals ein gewisses Aufsehen erregt hat. Der Artikel erschien unter dem Titel: "Gastarbeiter um der Mitgift willen." Tatsächlich gibt es mehrere Griechen in Deutschland oder sonstwo im Ausland, die zunächst allein dafür arbeiten, daß sie Geld für eine oder mehrere ihrer Schwestern sammeln. Man staunt darüber, daß dieses Geld von 6 oder gar 10 Jahren Arbeit dann ein anderer kassiert. Aber dies ist eben die Erfüllung einer fundamentalen Pflicht innerhalb der Familie. Von daher sollten Sie die Situation der Menschen sehen und besser verstehen, die in für sie oft äußerst harten Verhältnissen nun für so etwas arbeiten müssen.
Aus dem bisher Gesagten werden Sie sich schon nach der eigentlichen Stellung der Frau in unserer Gesellschaft gefragt haben. Ausländer pflegen in diesem Punkt pauschal zu urteilen. Sie sehen etwa kaum Frauen im Kaffeehaus und meinen gleich, die Frau sei hier unterdrückt und diskriminiert, desgleichen, wenn sie die Frau auf dem Feld arbeiten, das Vieh weiden, nach Hause mit Holz auf den Schultern zurückkehren sehen. Die Frau ist in Familie und Gesellschaft sicher nicht dem Mann gleichgestellt. Ich habe bereits von einem Patriarchalismus gesprochen. Abgesehen davon, daß heute sowohl die Gesetzgebung wie der gesamte soziale Wandel danach tendiert, Mann und Frau auf allen Gebieten gleichzustellen, darf man auch die Tatsache nicht ignorieren, daß selbst im Patriarchalismus unserer Tradition die Frau als Tochter zwar weitgehend eingeschränkt und vielleicht auch unterdrückt wird, als Ehefrau und vor allem als Mutter jedoch eine hohe und oft entscheidende Position im Leben der Familie innehat. Aber auch in der Geschichte unseres Volkes hat die Frau durch viele und wichtige Funktionen eine große Rolle gespielt. Zugleich lebt sie natürlich in und mit der Familie, sie nimmt an ihrem ganzen Leben teil, auch an der Arbeit. Im ganzen gesehen darf man wohl sagen, daß, wenn die Verantwortung des Mannes für die Frau in all den Konsequenzen richtig bemessen wird, die Frau hier in solch einem Schutz, in einer Geborgenheit lebt, die ihr keine Art der so genannten "Emanzipation" wird geben können. Dies soll natürlich keineswegs besagen, daß die Situation der Frau - vor allem in der älteren kretischen Gesellschaft - die idealste sei. Ganz im Gegenteil! Aber ebenso besorgt darf man auch über das Schicksal der Frau sein, die heute uneingeschränkt herausgefordert und vielfach im Leben der modernen Gesellschaft belastet wird.
Die Zusammengehörigkeit der Großfamilie zwingt jedes Glied, ihr ganzes Leben zu teilen. Am Beispiel der Blutrache kann man das kurz demonstrieren. Blutrache ist in allen Gesellschaften bekannt, wo eine strenge, öffentliche Justiz nicht oder nicht richtig funktioniert. Der Mensch fühlt sich dann veranlaßt, Gericht zu halten und selbst Rache zu üben. Sie verstehen, daß ein Volk, das durch so viele Jahrhunderte hindurch unter Fremdherrschaft sozusagen "gesetzlos" lebte bzw. als seine erste Aufgabe die Gesetzwidrigkeit ansah und sich freute, wenn es die Gesetze des Tyrannen übertreten konnte, immer in der Gefahr stand, eigene Gesetze zu entwickeln und nach diesen zu handeln. In unserem konkreten Fall war die Blutrache außerdem in gewisser Weise eine Notsituation des Menschen zur Verteidigung der Großfamilie und deren Stolz, welcher wiederum nötig war zur Erhaltung der Familie. Wir kennen leider Fälle, in denen ganze Familien durch Blutrache sich gegenseitig ausgerottet haben. Heute kommt das nicht mehr so oft vor; wenn doch, dann greift natürlich gleich die Justiz ein. Früher nahm das aber schlimme Ausmaße an. Daher versteht sich auch die große Bedeutung, die man in der Funktion des Priesters als Versöhner sah.
Erlauben Sie mir noch ein paar Worte zu einigen anderen Formen der Verwandschaft; zunächst die Blutsverbrüderung. Diese ist nicht mehr so häufig, aber doch nicht völlig unbekannt. Es handelt sich um einen Akt der Blutvermischung. Man schneidet die Adern auf und setzt die Hände an der Wundstelle in Kreuzesform aufeinander. Auf diese Weise mischt sich das Blut des einen mit dem Blut des anderen. Damit ist die Blutsverbrüderung vollzogen. Die Motive sind ganz verschieden, z.B. Versöhnung bei großen Konflikten. Der Konflikt wird also für immer beigelegt und es ist kaum mehr denkbar, daß danach die beiden Verbrüderten, ja auch deren Großfamilien, in irgend einen gefährlichen Streit miteinander geraten.
Ein anderes Motiv ist jenes der gemeinsamen Verantwortung. Vor allem in früheren Zeiten der harten Kämpfe, wenn etwa die Führer eines Aufstandes im Vorbereitungsstadium das Geheimnis festhalten mußten, machten sie diese Blutsverbrüderung. Dies geschah meistens auf dem Altar einer kleinen Kapelle - irgendwo auf einem Berg; es war so etwas wie ein liturgischer Akt. Ein weiterer Beweggrund kann eine Freundschaft sein zwischen zwei Menschen, die so gut ist, daß die beiden fürchten, diese könnte einmal in die Brüche gehen. So greifen sie zu der symbolischen Handlung der Verbrüderung für immer.
Eine andere, viel häufigere Verwandtschaftsform ist die geistige Verwandtschaft, die durch die Funktion des Trauzeugen und des Paten bei der Taufe entsteht. Der Taufpate in seinem Verhältnis zu den Eltern des Kindes heißt "Synteknos". "Syn" bedeutet "mit", "zusammen"; und "teknos" ist das Kind. Synteknos ist also der, der das Kind sozusagen mitgeboren hat. Die Taufe ist ja tatsächlich die neue, die eigentliche Geburt, und er ist also der zwei te Vater, gleichwie Paulus für seine Schüler sagte: ich habe dich im Glauben geboren. Der Pate hat dieselbe Verantwortung wie der Vater selbst. Wenn der Vater ausfällt, muß er die ganze Verantwortung für das Kind überneh men. Er hat vor allem die Verantwortung zu tragen für das Heranwachsen des Kindes im christlichen Glauben. Wie vieles, wird natürlich auch dieses in der Praxis nicht immer konsequent gehalten. Diese Verwandtschaft gilt aber fast mehr als die Blutsverwandtschaft, und zwar auch nach unserem Zivilrecht. Deshalb haben wir ein großes Problem, wenn jemand Pate ist bei einem Mädchen und einem Jungen, und beide wissen es später nicht und lernen sich gegenseitig kennen; sie sind ja Geschwister und können einander nicht heiraten. Deshalb ist es ratsam, entweder nur Mädchen zu taufen, oder nur Jungen. Die Taufe hat also nicht nur einen geistlichen Charakter, sondern auch einen sozialen; sie schafft neue Verwandtschaften und neue Freundschaften in der Gesellschaft.
Zum Schluß werden Sie mir erlauben, ein Wort über das zu sagen, was kretische Gastfreundschaft heißt. Wahrscheinlich werden Sie bereits gehört haben, daß die Gastfreundschaft, diese allgemein menschliche Eigenschaft, hier auf Kreta in besonderer Weise ausgeprägt ist. Interessant ist ja schon die Zusammensetzung des entsprechenden Wortes im Griechischen: "Filoxenia" ist die Freundschaft zum Fremden. Der Fremde ist der Unbekannte, der, vor dem ich mich in acht nehmen, vorsichtig mit ihm umgehen müßte, dessen Herkunft und Absichten ich erst zu ergründen hätte. Eigentlich ist der Fremde der, der in mir eher Furcht erregt und Zurückhaltung gebietet. Gerade diesen Menschen "Freund" zu nennen und als Freund aufzuneh men , ist sicher etwas Ungewöhnliches.
Dies Ungewöhnliche sehen wir tatsächlich in der griechischen Gastfreundschaft, die, wie gesagt, hier auf Kreta sehr spontan ist. Charakteristisch ist, daß hier der Gast auch "Musafiris" heißt; wieder eine interessante Wortzusammensetzung. "Musa" ist die "Muse”, und "fero" bedeutet "bringen". Der Gast also der musafiris, ist derjenige, der uns die Musen bringt, all die Gottheiten, in deren Gesellschaft auch die Muße Sinn und In halt erhält! Nicht er erwartet also etwas von uns, sondern er ist der Geber! Er schenkt uns die Freude, die Gemeinschaft, die Ehre. Wir sind die Empfangenden, wir schulden ihm Dank. Diese wohl eigenartige, humane Einstellung ist ohne Zweifel ein Überleben der alten, bekannten Freundlichkeit gegenüber dem Fremden, aber bestimmt auch die Frucht der christlichen Gesinnung. Ich will natürlich nicht leugnen, daß manchmal auch gewisse egoistische Motive eine Rolle spielen können. Etwa: Ein Fremder kommt ins Dorf und geht ins Kaffeehaus. Bald wird er von mehreren Menschen eingeladen, Gast bei ihnen zu sein. Der, der ihn zuletzt gewinnt, fühlt sich bestimmt ein bißchen stolz. Trotz solchen; etwas nagativen Beweggründen ist doch die Gastfreundschaft eine Eigenschaft des Menschen hier, über die wir sehr dankbar sind. Manchmal nimmt diese gastfreundliche Haltung sogar extreme Formen an. Dazu gehört z.B. das Verbergen großer Schmerzen und Leiden im Leben des Hauses, das Verbergen des Trauerns. Ich will damit meine Ausführungen schließen, indem ich Ihnen eine Parallele aus dem alten Hellas und aus dem modernen Kreta zeige. In der Tragödie "Alkestis" von Euripides kommt Herakles zu Admetos, dem König, und ist sein Gast. Dem König von Pherai war bekanntlich das Orakel zuteil geworden, daß er jung sterben müsse, es sei denn, ein anderer Mensch würde für ihn stellvertretend in den Tod gehen wollen. Das hat tatsächlich Alkestis, seine junge Frau getan. Am selben Tag kommt also Herakles auf der Durchreise in den Palast von Pherai. Alsbald merkt Herakles, daß irgend etwas Schlimmes sich abgespielt hat, daß eine Trauer da ist. Er fragt den Admetos, was denn los sei. Der König will zunächst nichts sagen, aber Herakles besteht darauf. Admetos sagt ihm, daß eine Frau aus dem Personal gestorben sei. Er bittet darum Herakles, in sein Appartement zu gehen und gibt Befehl, daß die Zwischentüren ganz verschlossen bleiben sollen, damit Herakles nicht das Stöhnen und das Weinen hört. Er bestellt für ihn das beste Essen, guten Wein und bleibt bei ihm, so'lange er kann. Am nächsten Tag kommt Herakles zufällig ins Gespräch mit einem Soldaten. Der Soldat ist sehr traurig und Herakles fragt: "Seid ihr alle hier so traurig über den Tod einer Frau des Dienstpersonals?" Der Soldat, ohne das Vorangegangene zu wissen, verrät ihm das Geheimnis, daß nämlich Alkestis selbst, die Frau des Admetos, die Verstorbene sei. Verwundert über die überaus große Gastfreundlichkeit des Admetos beschließt Herakles, in die Unterwelt zu gehen. Dort besiegt er den "Thanatos" (den Tod) und bringt Alkestis zurück als Belohnung dieser Art der edlen Handlung des Königs. Dieses Motiv des Verbergens der Trauer ist auch im modernen Kreta nicht unbekannt. Manchmal geschieht es, daß etwa bei einer Hochzeit jemand stirbt. Wenn es geht, gibt man das nicht bekannt, um die Freude des anderen nicht zu stören. Kazantzakis erzählt, daß es ihm selbst widerfahren sei, einmal in das Haus eines Priesters zu kommen, wo er nichts davon ge merkt habe, daß im Nebenraum die Frau des Priesters tot lag. Erst nachdem er weggegangen sei am nächsten Tag, habe er in einem anderen Ort über diesen Trauerfall erfahren.
Ein kretisches Volkslied, mit dem ich meine Ausführungen schließen möchte, bringt folgenden letzten Wunsch des sterbenden Jünglings zum Ausdruck:
"Mutter, wenn unsere Freunde kommen und unsere Verwandten, sag nicht, daß ich gestorben bin,
mache sie nicht schwermütig,
decke die Tafel, daß sie essen,
mach' ihnen das Bett zu schlafen,
schmücke das Sofa, daß sie dort die Waffen niederlegen.
Erst morgen, wenn sie aufstehn und von dir Abschied nehmen,
sage, daß ich gestorben bin."