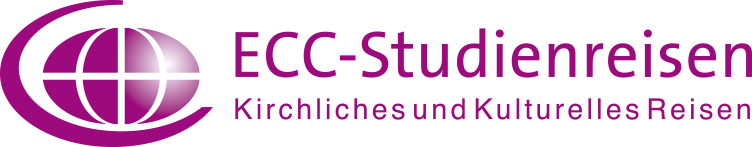Reisetagebuch von Pál Novelly: Studienreise, Gemeindereise nach Bulgarien
Der große Bismarck hat einmal gesagt: „Nur der Ochse ist konsequent“. Schon des-halb sind mir Leute, die es nicht sind, sympathisch. So steht es mit M. H., der sich von der Reiseführung verabschiedet hat, jetzt aber „rückfällig“ geworden ist, wovon wir alle profitiert haben. Nur, wenn er jetzt die nächste Reise plant, ist das eine zwei-te Inkonsequenz, oder Konsequenz in der Inkonsequenz? Wie dem auch sei, es war schön, und wir freuen uns auf die nächste Fahrt.
Nun, wenn wir schon dabei sind, eine kleine Geschichte:
Drei nicht mehr ganz junge Damen sitzen im Café. Die eine sagt: „Nächste Woche heirate ich und ich habe meinem zukünftigen Mann alles erzählt.“ Die zweite: „Dazu gehört aber Mut.“ Die dritte: „Und ein verdammt gutes Gedächtnis.“
Da der Schreiber dieser Zeilen kein „verdammt gutes Gedächtnis“ hat, bittet er um Nachsicht und ist für jede Ergänzung und Berichtigung dankbar.
Montag, 29. 3. - Sofia

Auf irgendeiner unserer Reisen müssen wir einen Regengott (oder Göttin?) beleidigt haben, am frühen Morgen regnet es wie aus Mollen, und wir haben kein Auto. Meine liebe Schwägerin ist im Krankenhaus. So werden die Koffer tapfer gerollt, und wir sind an der Bushaltestelle. Nach und nach trudeln die Anderen auch ein, aber alle sind pünktlich! Schon gleich nach der Abfahrt was bis jetzt noch nicht Erlebtes: Das Mikro funktioniert nicht. So muss M. H. seine Schäfchen ganz nahe bei sich ver-sammeln, um seine Mitteilungen zu machen. Und, wie immer, hatte er viel zu sagen. Dann ging in Hannover alles glatt, die Flüge waren so kurz, dass wir kaum Zeit hat-ten, die kostbare Verpflegung der Lufthansa zu genießen, und schon waren wir in Bulgarien. Am Fughafen neue Enttäuschung! Es gibt nichts Schöneres, als am frü-hen Morgen, schön müde, sich in eine lange Warteschlange einzureihen, entspre-chend müde und zuzusehen, wie es qualvoll langsam vorangeht. Aber hier! Drei Leute vor einem, eine junge lächelnde Bulgarin sieht einen Augenblick den Ausweis an, und die Sache ist erledigt. Und das nennen die Bulgaren Passkontrolle? Sie soll-ten Praktikanten nach Armenien, Usbekistan oder Israel schicken um zu lernen, wie man so etwas macht. (Es gab nicht einmal einen verlorenen Koffer oder einen israe-lischen Stempel im Pass, was die Sache etwas prickelnder gestaltet hätte.)
Unser Führer nahm uns gleich in Empfang. Im Allgemeinen gibt es drei Arten von Reiseführern: Manche haben von nichts eine Ahnung, die könnten gleich Berufspolitiker wer-den. Manche wissen über Land und Leute großartig Be-scheid, sind aber bei unerwarteten Schwierigkeiten hilflos. Wieder andere können eine zwanzigköpfige Reisegruppe innerhalb einer halben Stunde in einem vollbesetzten Hotel unterbringen, geraten aber in Schwierigkeiten, wenn sie außerhalb der auswendig gelernten Texte mit Sonderfragen konfrontiert werden. „Unser Mann in Bulgarien“ gehörte zu einer seltenen vierten Gruppe. Ehrlich vom Bestreben er-füllt, sein Land den Fremden zu zeigen, mit profunden Kenntnissen über Kunst, Re-ligion und Geschichte, im Organisatorischen vom Motto ausgehend „Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger“, war er ein Hauptgewinn für uns alle.
Etwas Geschichte:
Am besten folgt hier gleich ein kleiner Abriss, so kann man bei der Schilderung der einzelnen Tage Bezug darauf nehmen, oder ihn ergänzen.
Die ersten geschichtlich fassbaren Einwohner Bulgariens waren die Thraker (oder Thrazier). Sie entwickelten eine hohe materielle Kultur, organisierten sich in Groß-staaten, führten gegen die Nachfolger Alexanders des Großen Krieg, aber sie hatten keine Schrift. (Auch wenn einige übereifrige „Patrioten“ etwas anders sagen). Um die Zeitwende wurde Thrazien Bestandteil des römischen Reiches. Die Bevölkerung übernahm römische Sitten und die (etwas vereinfachte) lateinische Sprache. Nach der endgültigen Teilung des römischen Reiches (395) waren die thrazischen Provin-zen oströmisch. Wir nennen diese Staatsgebilde das byzantinische Reich, nach dem früheren griechischen Namen Konstantinopels „Byzanz“, die Bewohner nannten sich schlicht und einfach Römer, aber auf griechisch. Im VI. Jh. strömten slawische Sip-penverbände, wahrscheinlich vom Nordufer des Schwarzen Meeres, auf die Balkan-halbinsel. Diese Völkerbewegung war weniger spektakulär als die Völkerwanderung der Germanen, die eben als Völker unter der Führung von Königen durch das römi-sche Reich zogen. Die Balkanslawen wurden von einem zahlenmäßig wesentlich kleineren Volk, von den Bulgaren, auch Protobulgaren genannt, erobert und als Staat organisiert. Sie gaben den Südostslawen auch ihren Namen, etwa so wie die Franken den ein verdorbenes Latein sprechenden Galloromanen ihren Namen ver-liehen. Die ursprüngliche, romanisierte thrakische Bevölkerung wurde teilweise as-similiert, teilweise in die unwirtlichen Gebirgsgegenden vertrieben. Ihre Nachkom-men leben heute noch in Griechenland gerade in den kargsten Gebirgsgegenden als „Aromunen“. Der Großteil dieser Bevölkerungsgruppe wanderte nach dem Mongo-lensturm (Mitte des XIII.Jh.) in das von den Mongolen verwüstete Gebiet nördlich der unteren Donau ein. Sie bildete das rumänische Volk, das erst im XVII.Jh. erkannte, dass es ein romanisches (also nichtslawisches) Volk ist. Seltsamerweise haben sich die Rumänen noch bis heute nicht entschieden, ob sie von den Römern oder von den den Römern heldenhaft Widerstand leistenden Dakiern abstammen wollen. Nur von den armseligen, ein schlechtes Latein sprechenden Berghirten wollen sie nicht abstammen.
Doch zurück zu den Bulgaren. Trotz fast ständiger Kriege mit den Byzantinern haben sie sich, nach einigem Zögern, für die östliche Form des Christentums und damit für die byzantinische Kultur entschieden (etwa 90% der altbulgarischen Literatur besteht aus Übersetzungen griechischer Bücher religiösen Inhalts).
Die Christianisierung förderte auch den Slawisierungsprozess, so dass wir etwa seit 800 einem einheitlichen slawischen Volk gegenüber stehen. Es gab im Mittelalter zwei Bulgarische Reiche. Das erste von 679 bis 1018 und das zweite von 1018 bis 1396. Am Untergang des ersten Reiches waren die Bulgaren selbst mitschuldig, durch ständige Bürgerkriege zerfiel das Großreich in Teilfürstentümer. In der Schlacht von Belasica ließ der Kaiser Basilios II. 14.000 Gefangene blenden, nur jedem Hundersten ließ er ein Auge, damit sie die anderen führen konnten. Dafür be-kam er den als Lob gemeinten Titel „der Bulgarentöter“. Als der Herrscher des letz-ten Teilreiches, Samuel, diesen Zug der Gefangenen sah, soll er tot umgefallen sein. Das nach einem Aufstand wiedererstandene zweite bulgarische Reich war am An-fang auch mächtig, erlitt aber ebenfalls eine Zerstückelung. Am Ende stand die fast fünfhundertjährige Türkenherrschaft.
Die Türken waren sowohl ein Volk als auch eine Religionsgemeinschaft. Jeder, der sich zum Islam bekannte, konnte, ungeachtet seiner nationalen Abstammung, die höchsten Ämter bekleiden. Aber die Nichtmuslime bildeten die „Raja“ (wörtlich Her-de). Als solche konnte man sie melken, scheren und gelegentlich schlachten1. Wie es sich gehört, hüteten die Herde die eigenen Priester, die Befehlsgewalt über sie besaßen, aber gleichzeitig für ihr Verhalten verantwortlich waren und damit über die Christen so viel Macht besaßen wie niemals unter den byzantinischen Kaisern. Und dabei hatten die Bulgaren wiederum Pech. Der Patriarch von Konstantinopel wurde hoher türkischer Würdenträger und erhielt die Oberaufsicht auch über die bulgari-sche Kirche. Er benutzte sie dazu, alles Bulgarische möglichst auszumerzen. So wurden die Bulgaren politisch wie geistig unterdrückt. Erst im XVIII. Jh. begann, auch durch die Tätigkeit wohlhabender Kaufleute, eine nationale Wiedergeburt, die sich im XIX. Jh. verstärkt fortsetzte. Zuerst emanzipierte sich die Kirche. 1870 er-setzten bulgarische Priester das obligatorische Gebet für das Wohlergehen des Pa-triarchen durch ein Gebet für das Wohlergehen des Sultans. Dagegen konnte er doch nichts haben, er erlaubte sogar eine beschränkte Wiederherstellung der kirchli-chen Autonomie. Man kann annehmen, dass die religiösen Bulgaren niemals so in-nig gebetet haben wie jetzt, als sie es für den Sultan tun durften.
Dann trat Russland auf den Plan. Genau wie die U.S.A., die sich am wohlsten füh-len, wenn ihre Großmachtinteressen mit moralischen Postulaten irgendwie doch übereinstimmen, hatte Russland idealistische wie politische Motive. Die vorwiegend slawische und ausschließlich griechisch-orthodoxen Balkanvölker wurden tatsächlich von den Türken unterdrückt, Konstantinopel war tatsächlich der Mittelpunkt der or-thodoxen Kultur und jetzt in islamischer Hand, (man stelle ich vor, was es für die Ka-tholiken bedeutete, wenn Rom im X. Jh. von den Arabern erobert worden wäre, was eine kurze Zeit sogar möglich schien!). Anderseits aber hätte eine selbst indirekte Beherrschung Südosteuropas und der Besitz der Meerengen für das Zarenreich ei-nen ungeheueren Machtgewinn bedeutet. Das konnten und wollten die anderen eu-ropäische Mächte nicht zulassen. Dies erklärt die Bündniswechsel Russlands in den napoleonischen Kriegen. Aber weder Napoleon noch die konservativen Großmächte waren zu irgendwelchen Zugeständnissen bereit. 1855 versuchte es Russland auf eigene Faust. Aber die Westmächte (England, Frankreich) führten einen offenen Krieg, Hauptschauplatz war die Krim-Halbinsel, wo die riesige, als uneinnehmbar geltende Festung Sebastopol belagert und eingenommen wurde (daher „Krimkrieg“). Dieser Krieg entlarvte die Rückständigkeit Russlands, das die nach Napoleons Sturz stürmisch einsetzende industrielle Revolution so gut wie nicht mitmachte. Im nach-folgenden Pariser Frieden musste Russland die territoriale Integrität der Türkei be-stätigen, (woran es nicht im Traum ernsthaft dachte) und das Schwarze Meer neut-ralisieren, d.h. keine Festungen an der Küste und keine Kriegsschiffe auf dem Was-ser. Der nächste Zar, Alexander II., (1856-1881) beschloss, vieles anders zu ma-chen, er schaffte die Leibeigenschaft ab, reformierte Verwaltung, Justiz und die Or-ganisation der Armee. Dann wandte er sich der Außenpolitik zu. Der damalige preu-ßische Gesandte Bismarck bot ihm ein „Geschäft“ an. Von den fünf Großmächten führten zwei Krieg gegen Russland, die dritte, Österreich, war zwar offiziell neutral, unterstützte aber die Westmächte, wo es nur konnte. Es blieb also nur Preußen üb-rig. Es war aber die schwächste der Großmächte. Wenn aber Russland Preußen bei der deutschen Einigung unterstützt, wird ein mächtiges vereintes Deutschland Russ-land bei der „Lösung der orientalischen Frage“ behilflich sein. (Vorher war es anders, der deutsche Einigungsversuch 1848/49 war nicht zuletzt am russischen Veto ge-scheitert.) Russland schaute wohlwollend zu, als Preußen 1866 Österreich besiegte und als bei dem deutsch-französischen Krieg Österreich Gelüste zeigte, die Ent-scheidung von 1866 zu revidieren.
1 Da nur Nichtmuslime Steuern zahlten, waren die Türken an der Bekehrung nicht interessiert. (G. Weis)
Der Zar ließ seine Elitedivisionen an der österreichisch-russischen Grenze aufmarschieren. Russland kündigte auch die Neutralisie-rungsklausel des Pariser Friedens, erklärte sich aber England gegenüber als ver-handlungsbereit. Während in London russische und englische Diplomaten um jede Schiffstonnage und Festungskanone feilschten (die russischen Diplomaten hatten die Weisung, die Verhandlungen so in die Länge zu ziehen, wie es nur ging), mar-schierten deutsche Truppen Richtung Paris.
Russland rechnete also fest mit deutscher Unterstützung bei seinem Anliegen. 1875 brach in Herzegowina, 1877 in Bulgarien ein antitürkischer Aufstand aus. Die Türken reagierten mit der gewohnten Grausamkeit. Daraufhin griff Russland, fest mit deut-scher „Rückendeckung“ rechnend, die Türkei an.
Zuerst lief für Russland alles nach Wusch. Russische Truppen vernichteten mit ru-mänischer Hilfe die türkische Armee. (Rumänien streifte bei dieser Gelegenheit sei-nen Status als türkischer Vasallenstaat ab und wurde ein unabhängiges Königreich). Der Vorfrieden von San Stefano schaffte ein unabhängiges Großbulgarien, die Grenze der europäischen Türkei endete am Rande Konstantinopels. Damit war aber England nicht einverstanden. Englische Kriegsschiffe fuhren drohend in das goldene Horn ein, es drohte Krieg! Jetzt hoffte man in St. Petersburg auf deutsche „Rücken-deckung“.
Bismarck aber erklärte wörtlich: Die ganze orientalische Frage ist nicht den gesun-den Knochen eines pommerschen Grenadiers wert.“ (Diesen Spruch fanden alle zy-nisch und herzlos bis auf den besagten „pommerschen Grenadier“.) Er erklärte sich aber bereit, den „ehrlichen Makler“ zu spielen und in Berlin einen gesamteuropäi-schen Kongress stattfinden zu lassen. Dieser fand tatsächlich statt und veränderte den Vorfrieden von St. Stefano bis zur Unkenntlichkeit. Man fasste folgende Be-schlüsse:
1. Die europäische Türkei wurde, wenn auch im bescheideneren Maße, wie-derhergestellt.
2. Bulgarien wurde verkleinert und in ein unabhängiges Fürstentum „Nordbul-garien“ und ein von der Türkei abhängiges Fürstentum „Ostrumelien“ getrennt. Der neue Fürst Alexander von Battenberg war also zugleich souveräner Herrscher in Nordbulgarien und Vasallenfürst in Ostrumälien, was ein ziemlich hohes Maß an Schizophrenie erforderte. (Dies wurde übrigens von unserem nationalbewussten Führer nicht ganz klar dargestellt.)
3. Bosnien-Herzegowina sollte, um dort die Ruhe wiederherzustellen, von Ös-terreich besetzt und verwaltet werden, sollte aber weiter theoretisch zur Türkei gehören.
Diese Beschlüsse hatten zwei Ziele: Dem russischen Machtstreben sollte ein Riegel vorgeschoben und das „europäische Gleichgewicht“ gewahrt bleiben. Das sprach man offen aus. Die Türkei hatte sich aber während und wegen des Krieges über bei-de Ohren verschuldet. Sie wurde unter Kuratel gestellt, man richtete die „dette otto-mane“ (türkische Schuldenverwaltung) ein, eine Art IWF der Epoche. Man wusste also, je größer und relativ wohlhabender das Land blieb, umso eher bekam man sein Geld zurück.
Trotzdem wurde der Zar Alexander II. in Russland und in Bulgarien als „Zar Befreier“ hochgeehrt. Zu Recht schließlich befreite er in Russland die Leibeigenen und dazu die Bulgaren vom „türkischen Joch“. Anderseits wirft die Unterdrückung des polni-schen Aufstandes von 1863 einen dunklen Schatten auf seine Regierung.
Trotzdem bekam er in Sofia ein großes Standbild, eine Prachtstraße wurde nach ihm benannt und eine Kathedrale für seinen „Lieblingsheiligen“ Alexander Newskij ge-baut, der als Fürst von Nowgorod ein Heer des „Schwertordens“ (es war ein Seiten-zweig des Deutschen Ordens in Ostpreußen) besiegt hatte. Diese Ereignisse hinterließen ihre Spuren auch in der russischen Literatur. Der Held von Turgenjews Ro-man „Vorabend“ ist ein bulgarischer Freiheitsheld. (Laut unserem Führer ist das Werk Pflichtlektüre in bulgarischen Schulen.) Dostojewskij setzt sich in seinem „Ta-gebuch eines Schriftstellers“ leidenschaftlich für die Bulgaren und für die „Befrei-ungsmission“ Russlands ein. Er war ein großer Kenner der menschlichen Seele und gleichzeitig ein voreingenommener konservativer Nationalist. Tolstoj ist schon skep-tischer. Er lässt Bronski, den Liebhaber der Selbstmörderin Anna Karenina, als Frei-willigen zu den herzegowinischen Aufständischen fahren, von Zahnschmerzen ge-peinigt, enttäuscht von seinen zukünftigen Mitkämpfern. Natürlich waren die Bulga-ren mit ihrer Lage nicht zufrieden. 1885 proklamierte man die Vereinigung Nordbul-gariens und Ostrumeliens. Russland, das Österreich seit dem Berliner Kongress als seinen Hauptgegner betrachtete, protegierte das direkt an Österreich grenzende Serbien, das seinerseits mit einem Machtzuwachs Bulgariens nicht einverstanden war. Da aber Russland den Bulgarien erklärten Krieg verlor und jetzt gegen die Ver-größerung Bulgariens war, musste der erfolgreiche und nicht unpopuläre Fürst Ale-xander von Battenberg abdanken. Sein Nachfolger wurde Ferdinand von Coburg-Gotha, der aber die Politik seines Vorgängers fortsetzte. 1908 erklärte er sich zum König. (Die Bulgaren haben nur ein Wort für Herrscher, „Zar“ kann man auch als „König“ übersetzen.) 1912 verbündete sich Bulgarien mit Griechenland, Serbien und Montenegro und besiegte das türkische Reich. Wie schon im Vorfrieden von S. Ste-fano verlor das osmanische Reich seinen gesamten europäischen Besitz. Aber man konnte sich nicht über die Verteilung des Kriegsgewinns einigen, es kam zum zwei-ten Balkankrieg, in dem Griechenland, Serbien, Montenegro, die Türkei und das bis dahin neutrale Rumänien gegen die Bulgaren kämpften. Das Land verlor alles. Man versuchte, im I. Weltkrieg auf Seiten Deutschlands das Verlorene wiederzugewin-nen, dies führte aber zur endgültigen Niederlage im Frieden von Neuilly, wo Bulga-rien seine heutigen Grenzen erhielt. In der Zwischenkriegszeit führte die Entwicklung vom Parlamentarismus zu einer Art königlicher Diktatur. Im II. Weltkrieg verhalf Deutschland zum vorübergehenden Besitz von Makedonien, obwohl sich König Bo-ris standhaft weigerte, die Juden2 zu verfolgen oder an der Seite Deutschlands ge-gen die Sowjetunion zu kämpfen. Den Rest kennt Ihr, „Volksdemokratie“, Wende, große wirtschaftliche Schwierigkeiten, Korruption.
Eine kleine Kirchengeschichte (von einem Nichttheologen):
Kaum hatte die christliche Kirche die letzten Verfolgungen überstanden und erste Staatsreligion (noch nicht ausschließlich, das erfolgte erst 391) wurde, begannen in ihr erbitterte theologische Diskussionen. Es entstand ein explosives Gemisch aus griechischer Lust an haarspalterischen3 Diskussionen, orientalischer Ernsthaftigkeit, persönlichen Rivalitäten hoher Kirchenführer bei der Überzeugung, dass man, wenn man an das Falsche glaubt, der ewigen Verdammnis anheim falle4.
Zu dieser Zeit redeten sich die Leute die Köpfe über Glaubensfragen ebenso heiß wie heute über Politik oder Fußball. (Manchmal schlugen sie sich auch besagte Köp-fe ein). Zuerst ging es um die Gleichheit (nicht die Göttlichkeit!) des Sohnes mit dem Vater5, zugleich auch um die persönliche Rivalität zwischen dem Patriarchen von Alexandria, Athanasius, und seinem Priester, Arius, aus derselben Stadt Alexandria.
2 im Stammland (Materialien von H.P. Grumpe)
3 philosophisch über die Seinswesenheit Gottes kreisende (G. Weis)
4 Am Beginn steht Diokletians und Konstantins Überzeugung, dass nur die richtige Verehrung des Gottes Hilfe garantiert, daher die Reichsgesetze in Glaubensfragen, seit Konstantin gefasst von Bischofskonferenzen unter kaiserlichem Vorsitz (Kaisergericht) – die erste Anrufung des Kaisergerichts in Religionsfragen geschah übri-gens durch die christlichen Donatisten in Afrika. (G. Weis)
5 „geschaffen“ würde heißen, der Schöpfer ist größer, daher „geboren, nicht geschaffen“ – Frage der zwei We-senheiten als Gott und Mensch – kann Gott (der Allmächtige) leiden? (G. Weis)
Arius lehrte, dass der Sohn (Christus) nicht dem Vater gleich sein könne, denn: er sei geschaffen, also nicht von Anfang an existierend, und weil das Geschöpf niemals mit dem Schöpfer gleichrangig6 sei. Athanasius erwiderte, dass der Mensch mit sei-nem schwachen Verstand sich niemals erdreisten solle, in die letzten göttlichen Ge-heimnisse einzudringen. Der Kaiser Konstantin berief daraufhin das erste allgemei-ne7 Konzil der Geschichte nach Nicäa. An ihm nahmen die meisten Bischöfe des griechisch sprechenden Ostens teil, jedoch kaum welche aus dem „lateinischen Westen“, bis auf die Abgesandten des Bischofs von Rom. Wenn dieser zustimmte, akzeptierte der Westen die Beschlüsse, wenn nicht, kam es zur Spaltung. (Alle spä-teren Konzile verliefen nach dem gleichen Muster, dies trug auch dazu bei, dass aus den „Bischöfen von Rom“ Päpste wurden.) Das Konzil formulierte das Glaubensbe-kenntnis von Nicäa. Die Arianer blieben stur, als eine Art Opposition in der Kirche. Manche Kaiser bevorzugten später die eine, manche die andere Richtung, Bischöfe gingen in die Verbannung - und wurden wieder zurückgerufen. (Die später so belieb-te Ketzerverbrennung war noch nicht erfunden.) Folgenschwer war, dass der Kaiser Valens (364-376) die Arianer bevorzugte. Die großen germanischen Völker (Goten, Langobarden, Vandalen) wurden daher von Arianern christianisiert. (Der Bibelüber-setzer Wulfila war ein Arianer). Nach der Völkerwanderung gründeten diese Völker tatsächlich zusätzlich eigene arianische Sonderkirchen. Der Arianismus erlosch, als der Westgotenkönig Roderich zum Katholizismus übertrat und als Karl der Große das Langobardenreich vernichtete.
6 Der Schöpfer muss größer sein als das Geschöpf. (G. Weis)
Plötz 1960, S. 275: Aus seiner (heidnischen) Konzeption der Reichsreligion als Klammer des Reichs, weil Garant des Segens, erklärt sich Constantins Eingreifen in kirchliche Streitigkeiten. Um der geistigen Einheit des Reichs willen sucht Constantin seit 324 auch die Lehrmeinung der Kirche zu vereinheitlichen in östlicher Weise durch Synodalbeschluß (gegen den Primatsanspruch Roms) in Ablehnung der „subordinatianischen", d.h. den Sohn dem Gott Vater unterordnenden Lehre des Lucian von Antiochia und ihrer Verschärfung durch den 318 in Alexandria verurteilten Presbyter Arius als Lehre von der Homoiusia (Christus als geschaffen, nicht ewig und nicht gottgleich). Daher beruft der Kaiser ein angeblich von 318 Bischöfen (Vätern) gebildetes, aus dem Westen aber nur von 5 Bischöfen und päpstlichen Legaten besuchtes 1. ökumenisches Konzil in Nicaea (325), Formu-lierung des nicaeanischen Glaubensbekenntnisses nach der Lehre von der Gottgleichheit Christi (Homousia, Unterschied ein Jota) des Athanaius (Bischof von Alexandreia ab 328, verbannt (335-337). Constantin 337 auf dem Sterbebett getauft.
Die Verlegung der Reichshauptstadt nach Konstantinopel gibt dem christlichen Osten das Übergewicht, befreit aber das Papsttum von der Gefahr kaiserlichen Eingreifens und zwingt es in der Front gegen das wie-derstarkende Heidentum der Senatskreise zu geradlinigem Vorgehen. So Aufstieg des Papsttums (Silvester I. 314-335, Marcus 336, Julius I. 337 bis 352, Liberius 352-366, vor allem unter Damasus I. 366-384).
Unter Constantins schwachen Nachfolgern beginnt der kirchenpolitische Machtkampf zwischen den Bischöfen von Alexandria und Konstantinopel, den Athanasius (wieder verbannt 339-346) zum dogmatischen Streit zwi-schen Arianern und Athanasianern stempelt: Kirchenweihsynode von Antiochia 341 gegen Anerkennung des Athanasius durch Synode von Rom 340.
Die zum Ausgleich der Gegensätze von Westen und Osten berufene Synode von Serdica, nur aus dem Wes-ten besucht, erkennt Rom höchstrichterliche Befugnisse zu. Die Niederlage des Magnentius 353 wird zum Sieg des Arianertums (355) auch im Westen, doch bringen die gleichzeitigen Synoden von Rimini und Seleukeia 359 keine Lösung; Athanasius verwirft 362, 363 die arianische Lehre der sog. Pneumatornachen, daß der Heilige Geist nur Geschöpf des Gottsohnes sei.
361-363 Unblutige Christenverfolgung des Kaisers Julian
Gegenwirkung gegen seinen Neuplatonismus die Entwicklung der Predigt als theologischer Waffe, Gregor aus Nazianz 380 gegen die Arianer erfolgreich; mit der Lehre von 3 Personen Gottes in der einen Wesenheit (sog. jung-nicaeanische Formel) wird durch die kappadokischen Theologen eine Einigung angestrebt.
Die Verbannung führender Theologen in andere Reichsteile bewirkt den bisher fehlenden geistigen Aus-tausch. Athanasius macht während der Verbannung nach Trier (ab 356) das ägyptische Mönchtum dem Westen bekannt, Hilarius von Poitiers das bisher nur der östlichen Kirche aus griechischem Erbe eigene theologische Denken. Kleinasiatisches Magnatentum, Humanismus und christliche Liebestätigkeit verbinden sich in den sog. Kappadokisdien Kirchenvätern des Ostens, vor allem in Basileios von Caesarea.
7 Logischerweis die Bischöfe seines ganzen nun geeinten Reiches – wie früher als Westkaiser in seinem Gebiet. (G. Weis)
Viel folgenreicher war die Abspaltung der Monophysiten, die nach dem Konzil von Chalkedon 451 begann. Nach ihrer Lehre hatte Christus nur eine göttliche Natur und nicht eine Doppelnatur (menschlich und göttlich, wie die Orthodoxie es lehrte.) Der neue Glaube verbreitete sich rasch in Syrien und Ägypten. Dabei spielten auch sprachliche und nationale Gegensätze eine Rolle, das Griechische verlor seine Stel-lung als Kultur- und Kultsprache, die griechisch sprechenden Orthodoxen betrachte-te man als Unterdrücker. Dies erklärt, warum es den islamischen Eroberern gelang, diese Länder so schnell zu erobern. Nur die kaiserliche Armee leistete Widerstand, nicht die Bevölkerung. Es gibt heute noch monophysitische Minderheitenkirchen in Syrien und Ägypten, in Äthiopien ist der Monophysitismus Staatsreligion. Bei diesen beiden Lehren handelt es sich um zwei verschiedene Richtungen, zu verschiedenen Zeiten entstanden, mit beinahe gegensätzlichen Auffassungen. Man darf sie also nicht über einen Kamm scheren. Monophysitentum erkennt das Glaubensbekenntnis von Nicäa an, nicht aber dessen Ergänzung vom Konzil von Konstantinopel (381). Der oben erwähnte Arabersturm hatte auch sein Gutes. Das tüchtig verkleinerte by-zantinische Reich war griechisch sprechend und orthodox. Seine letzte große Krise erlebte die Orthodoxie im „Bilderstreit“ (Ikonoklasmus) von 728 - 843. Man verurteilte die Anbetung der Heiligenbilder als Götzenanbetung und vernichtete sie vielenorts8. Es ging den Kaisern dabei auch darum, das riesige Vermögen der Klöster zu be-schlagnahmen. Der Streit verlief in zwei Phasen, zwischen zwei Phasen setzte man sogar das Aussehen der Ikonen und ihre Plätze in den Kirchen fest. Es wäre nicht uninteressant zu erfahren, wie weit dieses Ereignis auf die damals schon christlichen Bulgaren auswirkte - oder blieb es eine rein innerbyzantinische Angelegenheit? Nach dem letztendlichen Kompromiss durfte es in den Kirchen keine Statuen geben, und die Ikonen durften verehrt, aber nicht angebetet werden.
Der Ikonoklasmus hatte zwei Perioden, dazwischen gab es sogar eine ikonen-freundliche Zeit, in der man den Malstil der Ikonen und ihre Stellung in den Kirchen verbindlich festgesetzt hat (767). Das war die letzte große geistige Auseinanderset-zung in der Ostkirche. Danach erstarrte sie in einem Immobilismus.
Es kamen noch atheistische Regierungen hinzu, die die Unnachgiebigkeit noch ver-stärkten.
Deshalb wäre es ratsam, wenn man die Ökumene will, darauf Rücksicht zu nehmen. Die Ostkirche will sozusagen dort weitermachen, wo sie 1917 bzw. 1945 aufgehört hat. Deshalb ein ungebetener Ratschlag: Hände weg von Nicäa, wenn man Zusam-menarbeit möchte.
8 Fischer-Weltgeschichte 13, Byzanz, S. 93: Die Ablehnung der Bilderverehrung entsprang sicherlich dem Ver-bot des Alten Testamentes und dem Vorwurf der Götzendienerei, der in den Diskussionen zwischen Christen, Moslems und Juden immer wieder eine große Rolle spielte. In diesen Auseinandersetzungen konnten auch nichtchristliche Theologen Einfluß auf die Byzantiner gewinnen. Das Verbot jeglicher religiöser Kunst in Mo-scheen scheint um 700 ergangen zu sein, während die Juden schon immer bildliche Darstellungen vermieden hatten. Aber im Jahr 721 dehnte Kalif Jezid II. diese Sitte der Moslems auch auf die Christen aus, die unter seiner Herrschaft lebten, und befahl die Zerstörung aller christlichen Ikonen. Da er in Syrien geboren war, muss-te Leon III. mit diesen Vorstellungen vertraut gewesen sein; offensichtlich war er sogar von ihnen überzeugt.
Unser erster Besuch galt der schon erwähnten Newskij Kathedrale. Imposant, sehr geschickt auf einen freien Platz gestellt, beherrscht sie das Stadtbild. Sie ist nach der traditionellen gleicharmigen Kreuzform gebaut, der Innenraum un ter der großen Kuppel ist imposant, mich persönlich beeindruckten die wunderbaren Lüster. Wir Westeuropäer sind von den Gemälden in unseren Kirchen sozusagen verwöhnt. Die Stile von der Romanik bis zur Moderne folgen ein-ander, die Themen sind freigestellt. Die Ikonenmaler waren in einen strengen Kanon eingezwängt, so-wohl was den Stil, die Themen, als auch was die Stelle der einzelnen Bilder betraf (siehe auch oben). Um so bewunderungswerter ist es, dass es vielen Malern gelang, eigenständige unverwechselbare Werke zu schaffen. Die Ikonen in dieser Kirche stel-len einen interessanten Versuch dar, von diesem Schema wegzukommen und zumindest teilweise dem Vorbild der akademischen westeuropäischen Malerei zu folgen. Imposant ist auch der Bischofsthron in der Mit-te des Hauptschiffes. Am selben Tag besuchten wir auch noch die Sophienkirche, im IV. Jh. gebaut, zweimal zerstört, ihre heutige Gestalt erhielt sie Ende des V., Anfang des VI. Jh’s. Sie ist auch eine Kreuzkirche. Man kann die solide, noch römische Zie-gelstruktur der Mauern bewundern, jawohl „bewundern“, die Römer verstanden noch etwas vom Bauen. Mir fielen die neuartigen fast wie naive Bilder wirkenden Ikonen auf.
Noch eine kleine Kirchengeschichte (garantiert zum letzten Mal):
Um 340 regierten die zwei Söhne Konstantins des Großen, Constans und Constan-tius. (In dieser Zeit scheint es Mode gewesen zu sein, Brüdern ähnliche Namen zu geben, wir kennen auch andere Beispiele.) Constans war streng orthodox, Contanti-us arianisch. Beide Brüder aber brauchten einander militärisch, so beschlossen sie ein Konzil nach Serdica (eben nach dem heutigen Sofia) einzuberufen, das in der Sophienkirche tagte. Hier aber beschimpften sich die Bischöfe einander wüst, lösten sich in zwei getrennt tagende Versammlungen auf, die sich gegenseitig verfluchten, worauf die beiden Kaiser entsetzt „ihre“ Bischöfe zurückriefen. Das Konzil ist nicht offiziell anerkannt Der Osten blieb bis zur Herrschaft des letzten gesamtrömischen Herrschers, Theodosius des Großen, arianisch, erst unter diesem setzte sich mit dem zweiten (jetzt allgemein anerkannten) Konzil von Konstantinopel 381 die Ortho-doxie im Osten durch.
Dienstag, 30. 3. - Sofia
Am nächsten Morgen ging es nach Bojana. Das ehemalige Bauerndorf mauserte sich zu einem vornehmen Villenvorort, während des Kommunismus zu einem bevor-zugten Funktionärsquartier, heute ist es ein Tummelplatz für „Neumillionäre“.
Bei diesem Anlass erfuhren wir auch etwas über die persönliche Familienumstände unseres Führers. Sein Vater, ein begabter Geograph, war in seiner beruflichen Lauf-bahn vom System stark behindert. Dieses Schicksal teilte er mit den Angehörigen vieler Mittelstandsfamilien. Das jetzige System sei immer noch von Korruption und schwierigen Lebensumständen für die Bevölkerungsmehrheit gekennzeichnet. Man behauptet sogar, kurz vor der Wende hätten führende Funktionäre das bisherige Staatseigentum unter sich aufgeteilt.
Unser Ziel war die weltberühmte Kirche von Bojana. Sie ist gestiftet in der zweiten Unabhängigkeitsperiode vom Kalojan, der als Sebastokrator (etwa: „erhabener Herr scher“ - das lateinische „Augustus“ wurde als „Sebastos“ ins Griechische übersetzt. Schon der Titel zeigt den trotz kriegerischer Auseinan-dersetzungen überwiegenden byzantinischen Einfluss). Sie wurde zweimal wiederaufgebaut bzw. erweitert, sie ist heute Weltkulturerbe. Die Hauptsehenswürdigkeiten sind natürlich die Fresken. Leider sind die älteren von neueren übermalt. In der Kuppel grüßt einen vorschrifts-gemäß Christus Pantokrator (der Allesbeherr-schende). Eine ganze Serie schildert das Leben des im Osten sehr verehrten heiligen Nikolaus (der, so viel ich weiß, dort den Kindern aber keine Süßigkeiten bringt). Die Bilder sind noch echte szenische Darstellungen, noch nicht ikonenhaft erstarrt. Der Heilige stürzt heidnische Statuen um, wird zum Bischof geweiht, bringt seinen Eltern ein gefangenes Kind zurück, lässt halbbeladene Ge-treideschiffe so tief sinken wie ein vollbeladenes, damit man nicht sieht, dass das Getreide für die hungernde Stadt entladen wurde (mein Lieblingswunder) etc. Natür-lich fehlen auch die „Soldatenheiligen“ nicht. Was aber die Kirche einmalig macht, sind die Porträts des Stifterehepaares und des amtierenden Zaren Konstantin Assen Tich und der Zarin. Der Stifter hält ein Modell der Kirche in der Hand. Die Gesichter sind von einer ungeheuren Lebendigkeit und Echtheit, man glaubt ihnen, dass sie so ausgesehen haben, während die Heiligenantlitze, vor allem die der Madonnen, von einem stark idealisierten griechischen Typus sind und an die italienische Frührenais-sance erinnern.
Nach diesem Wunder ein anderes, das Nationalhistorische Museum. Hier hatten wir das Vergnügen, an eine sehr kundige, sehr temperamentvolle und ausgezeichnet Deutsch sprechende Dame zu geraten. Man kann den Besuch in folgende Kapitel teilen: I. Gold, II. Thraker, III: Götter, IV: Römer, V. Bulgaren.
Zu I: Schon ein historisch nicht zu identifizierendes Urvolk entwickelte eine große Vorliebe für Gold. Es hinterließ Gefäße, unter anderen eine dreiteilige Schale mit Henkeln, fein gearbeitete Deckel, massive Armringe und andere Schmuckstücke und ihre eigenen Knochen. Was würden übrigens die Archäologen anfangen, wenn nicht alle Völker an ein sehr materielles Leben mit alltäg-lichen Bedürfnissen nach dem Tod geglaubt hät-ten? Die meisten müssten wohl Hartz IV beantra-gen. Die Thraker waren wahre Goldkünstler. Fas-zinierend sind die hornartigen Trinkgefäße mit Menschen- oder Tierköpfen, massive Schalen mit mythologischen Szenen, oft auch mit Schlangen verziert. Unsere Führerin erzählte uns, dass die Schlange noch heute in manchen Gegenden als glückbringendes Tier verehrt würde, und selbst wenn eine giftige Schlange sich dauernd in einem Bauernhaus niederlässt, dies als gutes Omen betrachtet werde und das Tier seiner-seits die Hausbewohner nie angreife. Es gab auch ebenso schön gearbeitete Silber-gefäße, und dann der „thrakische Reiter“, ein Kämpfer zu Pferde, wohl eine Hauptgottheit, unter den Pferdehufen ein anderes Pferd, am Anfang klar als solches zu erkennen, später zum Drachen umgedeutet. Von dieser Figur „stammt“ eine lange Reihe Helden-Götter- und Heiligengestalten ab, die Letzte ist der heilige Georg9. Damit sind wir schon bei den Göttern.
9 Schutzpatron der Janitscharen (sitzt hinter St. Georg), hilft der geraubten Prinzessin (unten rechts, Eltern in der Burg rechts oben). (G. Weis)
Ein großes kulturelles Erbe der Thraker ist die Gestalt des Gottes Orpheus, der als heiliger Sänger, Gott des Mystischen und des Weinrausches, der in mannigfaltigen Deutungen von den griechischen Dichtern bis Rilke und Offenbach weiterlebt. Dio-nysos, der Weingott, ein etwas derberer Geselle, wird ihm manchmal gleichgestellt. Aber auch der ist kein tumber Säufer, schließlich ist er auch Gott des Theaters und hat auch eine mystisch-religiöse Seite. Die wohl älteste Göttergestalt der Menschheit ist die „magna mater“, die Erd- und Fruchtbar-keitsgöttin, wohl schon in steinzeitlichen Ido-len erkennbar, auch von Thrakern, Griechen, Römern verehrt. Schon die ältesten Frauen-statuetten aus der Steinzeit deuten auf einen ähnlichen Kult hin.
Dann die Römer: gutes Karten- und Schrift-material illustriert die Eroberung und Provin-zialverwaltung des Imperiums. Einige schöne schwarz-weiße Mosaiken, unter anderen zwei elegante schwarze Fische, etwas Frühchristliches, das war es. Dann noch zwei höchst interessante Schautafeln. Auf der einen die von Kyrill erarbeitete „glagolische“ Schrift, die die Phonetik des Altsla-wischen genau wiedergibt, dann die von seinen aus Mähren vertriebenen Schülern ins Leben gerufene, fälschlicherweise kyrillisch genannte Schrift, die auf den damali-gen Formen der griechischen Schrift beruht und heute bei den griechisch-orthodoxen slawischen Völkern im Gebrauch ist.
Übrigens Schrift: Warum müssen alle Bulgaren, auch die Kompetentesten wie Mu-seumsmitarbeiter, Direktoren bei Ausgrabungen leugnen, dass die Thraker eben noch keine Schrift hatten? Einige griechische Inschriften von Herrschernamen oder der Name eines griechischen Malers im Fürstengrab von Kazanlak beweisen nicht das Gegenteil.
Leider endete damit unser Museumsbesuch. In der ersten Etage gab nämlich eine Ausstellung über die moderne bulgarische Geschichte, die ich gern gesehen hätte. Aber wir sind eine Gruppe, wenn auch eine sehr nette, private Wünsche werden nicht berücksichtigt. So ging es zu einem Café auf dem Hauptplatz, dann in die Syn-agoge. Dort trafen wir einen Bulgaren, der dort als Samstagsdiener und auch als eine Art Faktotum beschäftigt war. Er erzählte uns, dass noch Judeo-Spagnol ge-sprochen werde (als man die Juden Ende des XV. Jh’s. aus Spanien nach dem Na-hen Osten vertrieb, behielten sie ihr altertümliches Spanisch und reicherten es mit Worten aus orientalischen Sprachen und Hebräisch an, genau so, wie die während der Kreuzzüge nach Osteuropa vertriebenen Juden das mit slawischen und hebräi-schen Worten angereicherte Mittelhochdeutsch als „Jiddisch“ beibehielten). Unser Mann behauptete, diese Sprache und auch Englisch gelernt zu haben. Wir erfuhren, dass es relativ wenig Juden in Bulgarien gab, dass Rabbiner und Schächter nur ein-geflogen würden (korrigiert mich, wenn ich nicht alles genau verstanden habe). Er schien sich bei seiner Arbeit wohl zu fühlen. Am Ende nahm er das Trinkgeld mit der Bemerkung an, er sei kein Jude, er dürfe Geld anfassen (!?). Dann gingen wir zur evangelischen Gemeinde. Hier ließ mich mein alterndes Gehör im Stich.
Ich habe praktisch nichts verstanden. Wenn man es mit dem wunderschönen Nachmittag bei der evangelischen Gemeinde in Teheran vergleicht, war es eine ziemliche Enttäu-schung.
Dafür wurden wir am Abend entschädigt. Sehr gutes Essen, wunderbares Folklore-programm mit dem berühmten Lauf über's Feuer. Es wurde meistens nur am Rande gelaufen, trotzdem war es zu bewundern. Allerdings muss man bedenken, dass ein berühmter deutscher Fußballtrainer es (wohl unter leichtem „Kokseinfluss“ fer-tigbrachte, seine Spieler über Glasscherben laufen zu lassen.)
Mittwoch, 31. 3. – Koprivstica - Schipka-Pass - Sokolski-Kloster
Am nächsten Tag stand Koprivstica auf dem Programm. Es ist ein Dorf, wo es nicht nur Bauern gab, sondern auch reiche Fernhandeltreibende, sogenannte Vojniks. Deren Häuser bilden die Hauptsehenswürdigkeit des Ortes. Außerdem ist das Dorf der Ausgangspunkt des großen Aufstandes von 1877, also eine nationale Gedenk-stätte.
Unterwegs erzählte der Führer, politisch erfrischend inkorrekt über das Zigeuner-problem. Das eigentliche bulgarische Volk hat eine erschreckend niedrige Geburten-rate, die wohl auch durch das Bestreben der Eltern zu erklären ist, ihren Kindern ei-ne gute, also kostspielige Erziehung angedeihen zu lassen. Die Zigeuner haben die-se Sorge nicht und setzen bedenkenlos Kinder in die Welt. Diese wachsen oft als Analphabeten oder zumindest sehr ungebildet auf und sind in einer modernen In-dustriegesellschaft, die Bulgarien zumindest werden will, nicht zu gebrauchen. Wenn sie mit einem bulgarischen Pass ins Ausland gehen, fallen ihre (Un)taten auf die echten Bulgaren zurück (in unserer W.A.Z. stand auch ein großer Artikel über „bul-garische“ Prostituierte, die samt und sonders Zigeunerinnen waren). Der Staat steu-ert verzweifelt dagegen und gründet Internate, um diese Kinder besser aufzuziehen. Man muss unwillkürlich doch an die letzten ungarischen Wahlen denken. Diese „Transitländer“ sind einander doch sehr ähnlich. Wie zur Illustration des Gehörten begegneten wir einer Gruppe solcher Kinder mit ihren sehr sympathischen bulgari-schen Lehrerinnen und Lehrern. Manche hatten nette offene Gesichter, manchen hätte man nachts nicht alleine begegnen mögen (aber vielleicht tue ich ihnen un-recht). Auffallend war ihre Vorliebe für Schmuck, selbst Jungen trugen Ringe, Hals- und Gelenkketten etc.

Es ist kein Zufall, dass der Freiheitskampf gerade hier ausgebrochen ist. Die wohlhabenden und rela-tiv gebildeten „Vojniks“ sahen über den Tellerrand hinaus, sie überblickten die schlechte Lage ihres Volkes, aber sie erkannten auch die Chancen, die die allmähliche Dekadenz des Türkischen Reiches, des „kranken Mannes von Europa“, bot.
So gingen wir durch das Haus des Kaufmannes, sahen die erhöhte Nische, wo die Verschwörer sich beraten hatten. Er bezahlte seine Unterstützung des Freiheitskampfes mit seinem Leben. Ansonsten ist das Haus auch sehr interessant. Es überrascht, wie sehr selbst diese reichen Häuser auf Hauswirtschaft eingestellt waren: Textilien und Kleidung wurden grundsätzlich zu Hause angefertigt, man schlief auf Fellen, die Möbel waren richtige Bauernmöbel. Natürlich sind die Fest-tagskleider schön, ebenso der Silberschmuck der Frauen. Die Bulgarinnen scheinen eine richtige Vorliebe für Silber gehabt zu haben. Über die schwer-silbernen Gürtel-schnallen ließ Dagmar die Bemerkung fallen: Silberne Bh’s (aber, aber, Dagmar!).
Das nächste Haus war eine Art Revolutionsmuseum. Hier hingen Fahnen, waren
Waffen und Porträts der (meist sehr jungen) Revolutionsführer.

Mit allem Respekt, einer von ihnen hat sich beim Fotografiert-Werden richtig in Hel-denpose gesetzt. Im oberen Stockwerk befinden sich weitere historische Dokumente und Gegenstände. Wir hatten keine Zeit. Mit oberen Stockwerken und historischen Sachen, das scheint so mein Schicksal zu sein. Der Ort hat der bulgarischen Litera-tur auch einen großen Dichter geschenkt, Debeljanow. Sein Geburtshaus ist heute Museum. Vom Äußeren des Hauses zu urteilen, müssen die Eltern auch wohlha-bend gewesen sein. Der Dichter selbst fiel 1916 jung im Ersten Weltkrieg. Seine Themen waren: Liebe zur Mutter, deren Statue vor dem Haus steht, Sehnsucht nach der Heimat, Liebe zu einem jungen Mädchen (jeder Dichter, der etwas auf sich hält und nicht gerade Oscar Wilde heißt, muss eine große, möglichst unglückliche Liebe haben). Während unseres Besuches hörten wir seine Werke vom Tonband auf Deutsch rezitiert. Das Leben des Dichters ist gut dokumentiert. Man sieht Porträts, Fotos, persönliche Gegenstände, Dokumente seiner Militärlaufbahn und Erstausga-ben seiner Werke. Wenn ich es richtig gesehen habe, stammt die älteste von 1920. Demnach hat er seinen Ruhm als Schriftsteller überhaupt nicht erlebt. Ein tragisches Schicksal: Das große Bildnis seiner Angebeteten durfte auch nicht fehlen. Sie ist wohl anlässlich eines Maskenballes als Tatarin (es handelt sich, wohlge-merkt, um die in Russland wohnenden Tataren) dar-gestellt. Dies ist auch ein kleines Zeichen der Russ-land -Verbundenheit der Bulgaren.
Als letztes der Museums-Häuser stand das Haus eines ebenfalls reichen Händlers zu Besichtigung. Es ist kurz nach der vorletzten Jahrhundertwende ge-baut und zeigt die Fortschritte, die in einem halben Jahrhundert erreicht wurden. Die Einrichtung ist fast westlich, im Empfangsraum hängen gemalte Ansichten von den Städten, die der Hausherr besucht hat, (unter anderen Konstantinopel und Venedig).
Die Zeit degeneriert doch. Heute haben wir nur Fotos im Computer. In all' diesen Sehenswürdigkeiten wird das Verständnis dadurch erleichtert, dass alles ausschließ-lich auf Bulgarisch beschriftet wird. Man hat für uns auch eine Scheunenkirche auf-geschlossen, wo wir schöne Ikonen betrachten durften.
Jetzt etwas Grundsätzliches zu den Ikonen. Wir haben sehr viele gesehen. Sie äh-neln einander mehr als die Werke abendländischer Kunst. Einige machen subjektiv einen tiefen Eindruck. Die werden samt Eindruck beschrieben, die anderen erwähnt. Seid nicht böse und denkt an die drei bejahrten Damen.

Da der ursprünglich vorgesehene Trojan-Pass noch wegen Schnees unbefahrbar war, fuhren wir über den Schipka-Pass. Oh, der Schipka-Pass! Es werden Kindheitserinnerungen wach. Der schöne Spruch „Im Schipka-Pass ist alles wieder ruhig“, den man nach einem Streit sagte, wenn man sich geeinigt hatte oder des Streitens müde war. Die Reproduktionen des We-reschtschagin-Gemäldes mit dem gleichen Titel, die noch in manchen alten Wohnzimmern hingen, die Tür-kenbegeisterung in Ungarn (diese Begeisterung war eher Russenfeindschaft, denn im Jahre 1849 hat eine improvisierte ungarische Un-abhängigkeitsarmee das österreichische Heer praktisch geschlagen, woraufhin auf Österreichs Hilferuf Russland mit einer Riesenmacht den Freiheitskampf erstickte). Nun, ich hätte es nicht gedacht, wir fuhren tatsächlich durch den berühmten Pass und sahen eine große russische Gedächtniskirche in Weiß und Gold und ein pom-pöses Heldendenkmal. Der „Zuckerbäckerstil“ ist nicht eine Erfindung Stalins. Zum Abschied besuchten wir noch das Sokolski-Nonnenkloster ("Hl. Mariä Himmel-fahrt“). Das Hauptgebäude weist eine strenge, regelmäßige und quadratische Form auf, die kleine Kapelle, die wir von außen sehen durften, ist mit schönen Ikonen ge-schmückt. Den Tag beendete Gunna Weis, die leckeres Oster-Brot gekauft hatte und es jedem zum Kosten anbot, sowie der altslawische Regengott, der das Gewit-ter erst dann losließ, als alle schon im Bus saßen.
Donnerstag, 1. 4. - Veliko Tarnovo - Arbanassi

An diesem Tag erwartete uns Veliko Tarnovo, „die Königin der Städte“. Die Stadt war Hauptstadt des zweiten Bulgarischen Reiches und erster Sitz des neuerrichteten bulgarischen Staates. Sie ist heute eine typische Touristenstadt mit Andenkenläden, Gruppen besichtigender Besucher (oft fernöstlicher Herkunft), mit „Künstlerateliers“, wo seltene „Werke für die Ewigkeit“ geschaffen werden und mit so zahlreichen Loka-len, dass sie unmöglich nur von Einheimischen leben können. Das Ganze erinnert an die fränki-schen Städte, die ich mit einer anderen Gruppe im Sommer besucht habe. Zuerst fuhren wir aber hinauf zum „Zarenhügel“, vorbei an dem imponierenden Gebäude, wo die erste Bulgari-sche Nationalversammlung (missverständlich-erweise „Volksversammlung“ genannt) tagte und eine demokratische Verfassung ausarbeitete. Am Zarenhügel befindet sich die Peter-und-Pauls-Kirche. Auch sie ist ein historischer Schauplatz. Hier verschworen sich bulga-rische Adlige, zusammen mit dem Patriarchen, um das Land vom „Türkenjoch“ zu befreien. Die Verschwörung flog auf, die Teilnehmer wurden hingerichtet bis auf den Patriarchen, der „nur“ verbannt wurde. Die heimische Kirche bezahlte dies mit der Unterordnung unter das griechische Patriarchat.
Die Wandmalereien sind großartig, in dieser Zeit tagte eine „Vereinigunssynode“ in Ferrara10, so dass die Maler es sich erlauben konnten, vom traditionellen Ikonenstil abzuweichen. Auf einem Bild halten zwei Figuren das Modell der Kathedrale von Ferrara hoch, als Symbol der Vereinigung. Noch schöner ist die äußere Wand, man glaubt sich in die italienische Renaissance versetzt. Die Kirche war auch Schauplatz einer beispiellosen Barbarei. Bulgarische Geistliche hatten eine Bibliothek versteckt und hüteten sie Jahrhunderte lang, bis sie im 19. Jh’ von griechischen Priestern ent-deckt und vernichtet wurden.
Nach einem relativ anspruchsvollen Aufstieg erreicht man die beeindruckenden Rui-nen der alten Zarenburg. Es stehen zwar nur die Grundmauern, man kann aber die einstige Größe sehr gut vorstellen. Noch etwas oberhalb steht eine noch unter der kommunistischen Herrschaft aus Spenden und durch freiwillige Spenden errichtete neue Kirche. Die sehr interessanten modernen Bilder verknüpfen biblische Themen mit der Leidensgeschichte des bulgarischen Volkes. Vielleicht aus diesem Grunde ist die Kirche nie geweiht worden.
10 1437
Noch am Vormittag stand auch noch das Preobraschenskikloster auf dem Pro-gramm. Das ursprüngliche Kloster wurde von den Türken zerstört (die Mönche wollten dem Sultan das geben, was des Sultans ist), aber schon 1825 wie-der aufgebaut. Mehr als beachtenswert ist „das Rad des Lebens“, wo die menschliche Existenz, die Jah-reszeiten und astrologische Tierzeichen allegorisch miteinander verbunden sind. Unser Führer machte uns darauf aufmerksam, dass in der Christi-Geburtskirche ein ähnliches, aber noch größeres Lebensrad auf uns wartet.
Aber zwischen zwei Lebensrädern gab es etwas sehr Weltliches und überhaupt nicht Allegorisches, eine Weinprobe (in Ljaskovetz)! Ein Unterschied! Bei deutschen Weinproben kostet man den Wein nur und spuckt den Rest in dafür bereitgestellte Keramikkrüge (als wir einmal einen deutschen Winzer fragten, was mit dem Inhalt dieser Krüge geschehe, antwortete der: „Morgen kommt eine große japanische Gruppe“). Hier trinkt man den Wein ganz aus (alles andere wäre auch schade).

Aber zuletzt! Zuerst hebt man das Glas hoch und betrachtet die Farbe (besonderes bei Rotwein wichtig), dann riecht man vorsichtig daran, um den Duft auf sich wirken zu lassen. Erst danach darf man ihn langsam und mit Genuss austrinken. Neben den Weinen gab es auch Sekt und ein deftiges Essen (das Wort „Imbiss“ war eine Untertreibung). Eine in Teig eingebackene Füllung, dem serbischen „Pita“ ähnlich (eine türkische Hinterlassenschaft, die Türken waren nicht nur Barbaren). Die Kaufgelegen-heit nach der Weinprobe löste auch die immer heikle Frage des Mitbringsels (jedenfalls für uns, wir haben eine Flasche der Allgemeinheit „geopfert“, drei haben wir unversehrt nach Hause gerettet).
Am Nachmittag erwies sich ein alter lateinischer Spruch als wahr: Man sagt, „plenus venter non studet libenter“. Ebenso wahr ist: „plenus venter non spectat libenter“. Die fachkundige Dame, die uns die Kirche in Arbanassi erklärte, war zu bedauern. Es ist eigentlich schade, weil unser Reisebuch (Baedeker) fettgedruckt von einem „fan-tastischen, farbenprächtigen Bildprogramm“ schreibt. Nun, die meisten Sehenswür-digkeiten haben wir noch vor dem Alkoholkonsum genossen. Auf das ebenso ange-botene Konstanzaliev-Haus verzichtete ich weise und genoss die späte Sonne. Ver-säumnis des Tages: Es war der erste April, und niemand dachte an einen April-scherz!
Freitag, 2. 4. - Madara

Endlich eine schöne lange „Hankemeier-Busfahrt“ Dann aber, nichts für ungut, zu-mindest für mich persönlich, die Enttäuschung der Reise (glücklicherweise gab es nur diese eine). Der vielgerühmte „Reiter von Madara“. Da es vor allem im heuti-gen Iran so etwas gibt (herrliche Felsenreliefs), beweist er die westasiatische Her-kunft der Protobulgaren! Das Gleiche gilt übrigens für die Thraker, man nimmt an, dass sie Indoeuropäer waren und dass das heutige Albanische vom Thrakischen herkommt, beweisen lässt sich das aber nicht. Wie schon erwähnt, nach einer lan-gen Busfahrt und tüchtigem Treppensteigen (was aber nach der Fahrt nur gut tat) erreichten wir das Reiterstandbild oder das, was davon geblieben ist. Es gibt nur einige Konturen, das Ganze ist nur mit großer Einbildungskraft vorzustellen. Danach machten wir einen schönen Spaziergang zu den Höhlen. Es ist ein breiter Platz in einer erfrischenden Gebirgslandschaft. Und siehe da! Ein kurzer Weg genügte, und wir waren wie-der am Bus. Abends in der Nähe von Varna ging es noch zum Strand und durch riesige Hotelanla-gen zurück. Es gab nichts Tristeres als dieses spärlich besetzte Hotel, sozusagen noch im „Win-terhalbschlaf“, es schien so, als hätten sich alle Hotelgäste verabredet, in schlabberigen Trai-ningsanzügen rumzulaufen. Ansonsten mache ich mir viel zu wenig aus Kleidung, (zum Kummer meiner Frau), aber das dort war kein Anblick für die Götter. Im Allgemeinen, viele relativ arme Länder setzen auf Massentourismus. Das Ziel ist, möglichst viele Leute möglichst preiswert, aber einigermaßen bequem unterzubringen, sie so zu ernähren und unterhalten, dass sie zufrieden sind und im nächsten Jahr wiederkommen. Das Ergebnis ist überall ähnlich. Aber niemand von uns hat das Recht, sich Leuten, die meistens hart arbeiten und für sich und ihre Familie Erholung suchen, als „große Bildungsreisende“ überlegen zu fühlen.
Samstag, 3. 4. - Varna
Jetzt war Varna das Ziel. Zuerst eine Bemerkung: 1444 versuchte der damalige un-garische König Wladislaw (im Ungarischen Ulászló) Jagello den im Todeskampf lie-genden byzantinischen Staat (die Stadt fiel bekanntlich 1453) „herauszuhauen“. Er kam bis Varna. Hier verlor er Schlacht und Leben. Schuld waren natürlich die heim-tückischen Venezianer, die die Dardanellen, entgegen ihrem Versprechen, nicht vor der aus Kleinasien zurückkehrenden türkischen Armee sperrten. (Die Ungarn sind NIE an etwas schuld!) Soo, das musste auch mal bemerkt werden.
Unser erster Weg führte zur evangelisch-armenischen Gemeinde. Schon das Haus zeigte, dass diese Gemeinde wohlhabende Gönner hinter sich hat. Ein gut Deutsch sprechender Herr, der zwar kein Armenier war, aber mit einer Armenierin verheiratet, erzählte uns vom Innenleben der Gemeinde. Dann kam, in einem anderen Raum, ein junger Armenier hinzu, der kurz vor seiner Priesterweihe stand. Er musste über-setzt werden, bekam aber von unserem Führer das Kompliment, dass er ausge-zeichnet bulgarisch spreche. Übrigens wurde den in Bulgarien lebenden Deutschen auch das Kompliment gemacht, dass sie schnell und gut bulgarisch lernen (im All-gemeinen: je komplizierter die Grammatik der eigenen Muttersprache ist, umso leichter lernt man Fremdsprachen, deshalb sind Englischsprachige diesbezüglich im Nachteil). Dieser junge Herr schilderte uns die vielfältigen sozialen Aktivitäten der Gemeinde und ihr Verhältnis zu anderen Religionsgemeinschaften. Während der ganzen Zeit „wuselten“ wie selbstverständlich Kinder herum, alle machten einen net-ten, wohlerzogenen und wohlgekleideten Eindruck, kein Wunder, es war ja die Os-terwoche, die ausnahmsweise mit der „lateinischen“ Karwoche übereinstimmte.
Unsere Gruppe ähnelte in einem den spanische Conquistadoren, die Amerika heim-suchten, wir waren auch gierig nach Gold. Aber nicht, um die goldenen Kunstwerke einzuschmelzen oder gar zu vermünzen, wir wollten sie nur bewundern. Schon in Sofia waren wir fündig geworden, und in Varna war die Goldsuche auch höchst er-folgreich.
Am Karsamstag waren im Prinzip alle Museen zu. Aber der Spruch unseren Führers lautete: „Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder brauchen etwas länger“, so er-möglichte er uns, nur für uns allein, den Museumsbesuch samt einer charmanten und kompetenten Führerin (übrigens wurden wir überall von Damen geführt, mit ei-ner Ausnahme waren sie alle charmant und kompetent).
Varna ist eine uralte Siedlung, aber geschichtlich zu erfassen ist es als Odissa - eine griechische Hafenstadt, die, wie fast alle Griechenstädte, lange Zeit selbständig war. Das Museum begann natürlich mit we-sentlich älteren Sachen: Werkzeuge aus der älteren Steinzeit. Hier hätten wir die geübten Augen eines Wissenschaftlers haben müssen, um diese Werkzeuge von zufällig von Wasser und Wind bearbeite-ten Steinstücken zu unterscheiden. Das wurde mit der jüngeren Steinzeit anders. Die Gegenstände waren gut und bewusst bearbeitet, und das sah man ihnen auch an. Es ist doch keine leere Redensart, wenn man von der „neolithischen Revolu-tion“ spricht (außerdem hört sich das so richtig „gelehrt“ an, oder?). Dann aber Gold, Gold, Gold. Das Meiste stammt unmit-telbar aus der Gegend von Varna. Im Museum soll sich auch der älteste je gemachte Goldfund befinden. Mich beeindruckten am meisten die feinen kleinen Tierfiguren wohl religiöser Bedeutung. Es gab aber richtigen Schmuck, Applikationen, Griffbe-schläge, Armreifen, Ketten, Ringe. Im nächsten Saal dokumentierte eine sehr gute Landkarte mit Symbolen der einzelnen Orte (für Athen, die Akropolis, das Bild der Alexanderschlacht etc.), die mit Odissa Handelsbeziehungen pflegten. Mitten im Saal zwei griechische Vasen, es ist interessant, in manchen Museumsräumen ste-hen dutzendweise griechische Vasen herum. Man beachtet sie kaum. Hier, wo es nur zwei gab, war man für jedes Detail empfindlich. Natürlich gab es auch hier Gold, der thrakische Reiter durfte nicht fehlen, wir sahen auch Ketten und Ohrringe, auf einem ein fein ausgearbeitetes Bild der Siegesgöttin Nike, Schönheit und Religion gehen oft zusammen. Eine Herakles- und eine Nike-Statue, gute Provinzarbeit, aber schön wie alles aus dieser Zeit rundeten das Bild ab.

Im sog. „Steinernen Wald“ gibt es auch etwas Einmaliges: Aus einem sandigen ehemaligen Meeresboden ragen riesige Felssäulen empor, so regelmäßig geformt, dass man sie im XIX. Jh. noch für griechische Säulen hielt, bis man versteinerte Meerestiere in ihnen entdeckte. Heute wissen wir, dass sie, ähnlich wie in Tropf-steinhöhlen, aus dem warmen seichten Wasser herausgewachsen sind. Manche erinnern an menschliche Figuren, manche anderen wecken andere Assoziationen, gleich die erste Säule bekam eine leicht anrüchige Bezeichnung (aber dem Reinen ist alles rein). Unser nicht besonders guter Führer (zum ersten und zum letzten Mal) erklärte uns ihr Zustandekommen, was ich nicht ganz verstand, aber es gibt dafür etwa 20 Theorien, woher soll man wissen, welche die richtige ist? Nur, ehemalige warme seichte Meeresböden gibt es wohl auch woanders, diese Erscheinung ist, so viel ich weiß, einmalig.
Abends gingen wir durch die Innenstadt zum Restaurant. Wir warfen auch kurze Bli-cke in zwei Kirchen. Für mich persönlich war das schöne Opernhaus irgendwie wichtiger. Ein Blick auf das Programm: Es gab schöne Opern, z. B. La Traviata, aber nicht an unserem Besuchstag. An dem gab es ein Schumann-Konzert, und das ist nicht jedermanns Sache. Hier war ich von unserem Führer etwas enttäuscht. Er hät-te für uns auch eine schöne Opernvorstellung arrangieren sollen, anderseits, was sollen Pappmaché-Säulen auf der Bühne, wenn man echte gesehen hat?
Ostersonntag, 4. 4. - Nessebar

Das erste Mal, dass ich in eine Stadt komme, die ich schon kenne. Nach einem Hausbau hat man normalerweise kein Geld. Deshalb hatten wir eine „Sparreise“ nach Bulgarien gebucht. Sie war auch danach. Aber der kleine Ausflug nach Nessebar war schön. Was einem in der Altstadt sofort auffällt, sind die wunderschön ge-schnitzten hölzernen hervorragenden Erker. Wir dachten damals, dass alle Altstädte in Bulgarien so seien. Irrtum. In anderen Städten haben wir nur manchmal solche Erker gesehen. Es muss eine Spezialität von hier sein. Wir haben den Ort auch von der Meerseite, d. h. vom Boot aus, kennen gelernt. Das Wetter für eine kleine Bootstour war geradezu ideal. Der Himmel war vor-schriftsmäßig himmelblau, und die Sonne schien. Es war höchstwahrscheinlich der wärmste Tag der ganzen Reise. Und so ge-nossen wir und so sahen wir alte Häuser und moderne Hotelkästen vor uns langsam auftauchen und ebenso langsam verschwin-den. Nach einem kurzen Mittagessen mit gutem Rotwein (der ist hier immer gut) und Fisch (man musste sich durch kleine Fischstücke voller Gräten mühsam hindurcharbeiten, um zu einem großen, schmackhaften Fischfilet fast ohne Gräten zu gelangen, aber die Vorsuppe war köst-lich) hieß es: „Genug gefaulenzt, auf zur Besichtigungsarbeit!“ Nessebar hat laut In-ternet 41 Kirchen. Wir haben nicht alle gesehen. Aber wir haben genug gesehen, dass mein Gedächtnis mir gelegentlich einen Streich spielt. So ist das alles, was jetzt kommt, „ohne Gewähr“, wie bei den Lottozahlen, nur dass man nichts dabei zu gewinnen hat. Zuerst musste die Kathedrale besichtigt werden, weil später der Os-tergottesdienst beginnen sollte. In ihr herrschte schon eine erwartungsvolle Atmo-sphäre. Die Gläubigen standen mit Kerzen in der Hand herum, manche Kerzen brannten schon. Es duftete leicht und nicht so unangenehm wie in armenischen Kir-chen nach Weihrauch. Die Ikonen waren relativ modern, es fiel auf, dass man die heilige Helena, die Mutter Konstantins des Großen, in bulgarischer Bauerntracht ab-gebildet hatte. Es ist absolut richtig, schließlich war sie eine einfache Gastwirtstoch-ter. Die älteste Kirche der Stadt ist die Alte Metropoliten-Kirche, heute in Ruinen (IV.- V. Jh.) wirkt die ehemalige Hauptkirche, dreischiffig, mit zwei Arkadenstockwerken und wuchtigen Pfeilern, soliden Mauern erbaut, teils aus Ziegelsteinen, teils aus Na-tursteinen, heute noch imposant. Also nichts mit den schnell hochgezogenen „Not-bauten“11 (laut Vortrag von Georg) unmittelbar nach dem Sieg des Christentums. Hier erzählte unser Führer interessant über die Entwicklung der Ikonostase. Zuerst relativ niedrig, etwa wie unsere Lettner vor dem tridentinischen Konzil, wurden die Ikonostasen immer höher, bis sie den Gottesdienst vollkommen von den Gläubigen abschirmten. In den Ruinen sah man einige Jungs Fußball spielen. Nicht auffällig, oder aufdringlich, richtig nett. So ist es gut, junges Leben in alten Gemäuern. Unser nächster Besuch galt der Pantokratorkirche. Sie stammt aus dem Mittelalter, XIII.- XIV. Jh. und ist laut Baedeker „ein Höhepunkt mittelalterlicher bulgarischer Architek-tur“; wie die meisten byzantinischer Kirchen ist sie eine Kreuzkuppelkirche. Wie die alte Metropolitenkirche weist sie auch einen harmonischen Wechsel von Natur- und Ziegelsteinen auf. Wenn mein Gedächtnis nicht täuscht, fand im Kirchenraum eine Art Ausstellung und Verkaufsmesse statt. Es sind eben kommerzielle Bilder, ob auf dem Montmartre, in Veliki Tarnovo, oder eben in Nessebar. Aber vielleicht wird einer der Maler berühmt, und man hat eine gute Investition getätigt. Ganz andere Kunst-werke haben wir in den beiden anderen Kirchen, in der Stefan- und in der Erlöserkir-che gesehen. Sie wurden extra für uns aufgemacht. Ein Bild in der Erlöserkirche bleibt für immer im Gedächtnis haften, eigentlich zwei Bilder. Oben sieht man Chris-tus, der seine Gewänder zerreißt, (schon im Altertum höchstes Zeichen der Trauer, unten sah man Arius aus der Hölle die Wesensgleichheit von Vater und Sohn leug-nen. Ich schreibe „sah“, man hatte ihn schwarz übermalt, den gemeinen Ketzer.) Danach betrachteten wir von außen zwei in der türkischen Zeit gebaute Taufkirchen. Eine größere für Knaben, eine kleinere für Mädchen. Das ist auch korrekt so, nicht wahr, Frau Alice Schwarzer?
11 Gemeint waren Konstantins Basiliken in Rom aus Säulen-Spolien, geraden Seitenwänden und dem Vorhof mit Spoliensäulen, so dass mit geringem Aufwand in Rom Riesenkirchen (Peterskirche, Lateran, San Paolo fuori le mura) entstanden. - Der Sieg des Christentums trifft nicht zu. Das Christentum wurde der heidnischen Staatsreligion gleichgestellt, wenn man für das Reich betet, was Christen ohnehin taten (als Hilfe Gottes zur Mission): staatlich bezahlte Kirchen, Steuerfreiheit der Priester etc. (G. Weis)
Montag, 4.4. – Kazanlak - Starosel
An diesem Tag waren wir wieder auf Goldsuche. Aber was Gold unter den Elemen-ten ist, ist die Rose unter den Blumen. So war es auch ein Tag der Rosen. In Bulga-rien hat die Rosenzucht auch eine große wirtschaftliche Bedeutung. Die Blumen werden in erster Linie nicht wegen ihrer Schönheit, sondern wegen ihres Öls ge-züchtet. Das Öl allein oder im Gemisch dient zur Parfumherstellung. Aber man kann vieles andere daraus machen. Was, das erfuhren wir beim Besuch des Rosenmuse-ums. Man kann es zum Likör verarbeiten (unter uns, regelmäßiger Konsum von Ro-senlikör ist die beste Methode zum eingefleischten Abstinenzler zu werden). Man kann daraus Marmelade machen, schmeckt nicht schlecht. Schließlich stellt man auch Handcreme daraus her. Die Damen behaupteten, es sei sehr angenehm. Eig-nete sich auch als Mitbringsel für Daheimgebliebene weiblichen Geschlechts. Wir fuhren auch an Rosenfeldern vorbei. Leider blühte noch nichts. Bei Rosenblüte müs-sen die Sträucher zauberhaft aussehen.
Jetzt aber: Thraker, Gräber und Gelehrte, in Kazanlak. Von Letzteren war nur einer anwesend, aber was für einer: der leitende Direktor der Ausgrabungen persönlich, ein alter Bekannter un-seres Führers, der uns die Ehre gab. Weltberühmt ist das Grab von Kasanlak. Weltkulturerbe! Im Vorraum erläuterte uns der besagte Herr die Fotos. Sie zeigen die verschiedenen Phasen der Ausgrabungsarbeiten und die Tagungen eines Ausschusses. Es ging dabei um Folgendes: Die sozialistische Regierung Bulga-riens hat in den fünfziger Jahren die ehemalige Haupt-stadt des Königs Seuthos III., Seuthopopolis, von ei-nem Stausee (heute Koprinkasee) überfluten lassen. Wir haben auch dieses Gewässer besichtigt. Aber au-ßer dem Bewusstsein, dass hier einmal eine Stadt war, bringt es einem nicht viel.
Jetzt will man, wenn ich es richtig verstanden habe, besagte Stadt mitten im See mit einem runden Damm umschließen und sie den Touristen zugänglich machen. So etwas kostet natürlich etwas und zieht Folgekosten nach sich. Niemand vermag zu sagen, ob hier eine Touristenattraktion entstehen wird, die sich bezahlt macht. Im gleichen Vorraum gab es einige schöne Originalgegenstände in Vitrinen. Leider verstand ich akustisch immer dann schlecht, wenn erst aus dem Bulgarischen über-setzt wurde. Für eine Ergänzung wäre ich dankbar. Die Gemälde im Grabraum kennt Ihr alle. Wir haben sie gesehen. Aber jetzt einige ketzerische Bemerkungen, und ich hoffe, dafür nicht verbrannt zu werden. Das Grabmal ist eine Nachahmung. Sie könnte ebenso in Sofia oder in Lage/Lippe stehen (eine schreckliche Vorstellung).

Man sagt, dass der menschliche Atem den Bildern schade. Gut. Aber wenn man ext-ra bezahlt, 10 Lewa, schadet er nicht. Man versteht, dass die Bulgaren auf dieses künstlerisch außerordentlich begabte Volk, das in ihrem Land lebte, stolz sind. Man hat auch Verständnis dafür, dass dieses Grab als Nationaldenkmal gehegt und ge-pflegt wird. Nur war der Maler ein Grieche, der sogar seinen Namen hinterlassen hat, was für diese Zeit ungewöhnlich ist. Ebenso wenig wie der großartige Hauptsaal im Würzburger Bischofspalast (den und das Velberter Kultur-zentrum muss jeder einmal in seinem Leben gesehen ha-ben), der von Tiepolo und seinen Söhnen bemalt worden ist, ein deutsches Kulturdenkmal ist, ebenso wenig ist das eine thrakische, geschweige denn eine bulgarische Hinterlassen-schaft. Der dritte Punkt ist die Schreibfähigkeit bzw. fehlende Schreibfähigkeit der Thraker. Selbst der bestimmt hochgebil-dete Museumsdirektor brach eine Lanze dafür, dass sie schriftkundig waren. Der beste Beweis dafür ist, dass wir gar nicht wussten, wessen Grab wir besichtigt ha-ben. Die Thraker konnten oder wollten nicht schreiben. (Man weiß, dass in Gallien die Schreibkultur von einer konservativen Priesterschaft bewusst verhindert wurde.
Es mag sein, dass es in Thrakien ähnlich war.) Die Tatsache, dass einige thrakische Herrscher ihre Namen in griechischen Buchstaben haben verewigen lassen, ist kein Beweis für eine allgemeine Schreibfähigkeit.
Schade nur, dass wir deshalb nicht wissen, wie die thrakische Sprache beschaffen war, also zu welcher Völkerfamilie das Volk gehörte. Das nächste Mal hatten wir die Genugtuung, ein „echtes“ Fürsten-grab, das von Ostruscha, zu besichtigen, wobei niemand wusste, um welchen Fürs-ten es hier gegangen ist. Es wurde extra für uns geöffnet, der bulgarische Archäologe war noch dabei. Wir konnten nur kleingruppenweise hineinkriechen, aber es lohnte sich. Im Inneren gab es schöne, relativ gut erhaltene Fresken. Im Üb-rigen wurde das Grab ausgeraubt. Aber das war eine kleine, wenn auch wohlschmeckende Vorspeise. Das Hauptgericht kam noch, das Grab Seuthos des III. (In unserem Reisepro-gramm ist er anders geschrieben, aber mit der Transkription von in griechischen Buchstaben geschriebenen thrakischen Namen ist es so 'ne Sache.) Die Anlage war nicht als Grab-stätte errichtet, sondern als Orpheus- oder Dionysos-Tempel. Diese beiden Götter waren oft miteinander verwechselt oder in eine Göttergestalt verschmolzen worden. Da die Anlage, wie die meisten thraki-schen Tempel, höhlenartig in einen Berghang getrieben worden war, eignete sie sich auch als Grabstätte. Im Vorraum findet man eine Kopie des bronzenen Herrscher-kopfes. Sie zeigt das Gesicht eines bärtigen Mannes „im besten Alter“ mit energi-schen, herrschaftsgewohnten Zügen (ob er tatsächlich so ausgesehen hat, ist eine andere Frage, bekanntlich haben die Griechen bei Bildnissen idealisiert, die Römerporträts waren realistisch). Der König bekam ein wunderbares, wohl zu Repräsenta-tionszwecken dienendes Schwert, (er muss sehr kräftig gewesen sein, wenn er es handhaben konnte). Aus der übrigen Kriegsausrüstung beeindruckten noch der Helm und der großartige „Helmkranz“. Es sind feine Blätter aus Gold, die zu einem Kranz zusammengestellt sind. Mit dem Namen hat es so seine „Bewandtnis“. Man hat festgestellt, dass der Kranz für einen Kopf zu groß ist. Dann entdeckten die Ge-lehrten, dass der Kranz auf dem Helm getragen wurde, auf dem zu diesem Behuf zwei hasenohrartige Spitzen angebracht wurden ('Tschuldigung). Eine kleine Ent-täuschung, der Kranz war ein Duplikat. Natürlich gibt es ihn. Außerdem stellte man goldene Gefäße mit Wein, sein Szepter und andere Gegenstände hin. Mit Ausnah-me des Kopfes befinden sich die meisten der beschriebenen Objekte im kleinsten hinteren Raum, in der eigentlichen Begräbniskammer, in die man sich regelrecht hineinzwängen muss. Deshalb waren wir egoistischer Weise froh, dass außer uns praktisch niemand da war, bis glücklicherweise erst fast am Ende unserer Besichti-gung, bulgarische Schulkinder kamen. Einerseits ist es schön, dass sie die Schön-heiten ihres Landes kennen lernen, anderseits, ja, anderseits können sie ja jeden Tag hinkommen.
Aber damit war des Goldes und der Thraker noch kein Ende, im Gegenteil! Das Iskra-Museum stand uns offen. Der Name ist nicht uninteressant, „iskra“ heißt im Russischen und vielleicht auch im Bulgarischen der „Funke“. So hieß aber auch Le-nins Zeitschrift, mit der er sinnvollerweise von Deutschland aus versuchte, in Russ-land das revolutionäre Feuer zu entfachen. Deshalb hießen in Ungarn und wohl auch in anderen „Volksdemokratien“ etliche Institutionen (Sportvereine etc.) so. Hier gibt es im Iskra-Institut neben dem Museum auch eine Bibliothek, Theater, Kino etc. Es ist also fast so interessant und vielseitig wie unser Kulturzentrum in Velbert (wo sich das einzige Schloss- und Beschläge-Museum Deutschlands befindet, also hin-fahren, ansehen, staunen!) Soo! Jetzt wisst Ihr es! M. H. meinte, dass es schade sei, dass viele Gegenstände zu einer anderen Ausstellung ausgeliehen seien. Trotzdem bekamen wir genug zu sehen. An erster Stelle den echten goldenen Kranz. An zwei-ter ein Duplikat der noch berühmteren goldenen Totenmaske des Herrschers. Zu sehen sind andere Gegenstände, Waffen, Schmuck, Gefäße etc.
Das Leben von Seuthes III. ist auch gut beschrieben. Er einigte die thrakischen Stämme zu einem Königreich, gründete eine neue Hauptstadt, die er bescheidener-weise nach sich selbst benannte, führte Krieg, unter anderen, was erlaubt, ihn in der Zeit sozusagen unterzubringen, auch gegen den Diadochen (Nachfolger Alexanders des Grossen) Lysimachos. Der hatte eine Schwester namens Berenike. Das allein macht ihn irgendwie sympathisch. Eine jüdische Prinzessin dieses Namens war die große Liebe des späteren Kaisers Titus, auf die er aus Staatsräson verzichtet hat. Nachzulesen bei den großen römischen Geschichtsschreibern und bei dem franzö-sischen Tragödiendichter Racine (Bérénice). Auf diese Weise macht ein griechischer Frauenname Karriere bei den „thrakischen Barbaren“ und bei hellenisierten Juden. „Ist das nicht schön?“ würde eine leider abwesende Dame sagen.

Jetzt wurde aber Zeit, dass wir einen thrakischen Tempel sahen, der nicht als könig-liche Grabstätte „entfremdet“ worden war. Wir fanden ihn in Starosel. Zuerst kam ein nach der langen Busfahrt wohltuender, gerade richtiger, also nicht allzu langer Aufstieg, wobei die thrakischen Götter uns Gnade erwiesen. Während der ganzen Zeit hingen Wolken über unseren Köpfen, aber geregnet hat es nicht. Und jetzt ver-mischen sich eigene Erinnerungen, leider nur bruchstückhaft Gehörtes und später Beschafftes: Der Tempel ist wohl nach thrakischer Sitte in den Berghang getrieben, also eine Art künstliche Höhle. Eine imposante Treppe führt in einen großen mit ei-ner Kuppel nach oben endenden Raum. Irgendwelche Dekorationen fehlten (jedenfalls ist mir nichts aufgefallen). Die großen Steinquader sind sehr „sauber“ aneinan-dergefügt, die Bauweise erinnert an die Inkabauten, wo ebenfalls „kein Blatt Papier dazwischen passt“. Momen-tan wird die Anlage mit Holzpfählen und Kunststoffpla-nen geschützt (nicht ganz altthrakisch). Im Tempel sol-len Orpheus, die Erdgöttin und ihr gemeinsamer Sohn, der „thrakische Reiter“, verehrt worden sein. Die ganze thrakische Mythologie ist ja nur mit griechischer Ver-mittlung an uns gekommen. In einer anderen Informati-on steht es anders. Im Tempel habe man die uralte Göttin des Herdenfeuers Hesta (lat. Vesta) verehrt und ihr große Brote als Opferga-be gebracht (demnach waren die Thraker zweifellos Indoeuropäer). Außerdem wur-den die toten thrakischen Herrscher dort aufgebahrt und zu Halbgöttern (lat. divus) erklärt, bevor sie woanders begraben wurden, ähnlich ihren römischen „Kollegen“, die aber, wenn sie schlecht regierten, auch der „Verfluchung des Andenkens“ (dam-natio memoriae) anheimfallen konnten, man erklärte sie sozusagen zu „Unperso-nen“. Ob das die Thraker mit schlechten Herrschern auch taten? (Dies alles steht in unserem Baedeker.) Unsere Führerin erzählte wiederum von Tieropfern, wobei man ein Drittel des Fleisches den Göttern, ein Drittel den Vornehmen (Adel und Priester) und ein Drittel dem Volk zukommen ließ. Übrigens, Führerin. Als eine andere Grup-pe kam, verlor sie das Interesse an uns, recht geschieht 's ihr, sie bekam kein Trink-geld. Die Thrakergötter waren wiederum gnädig, während unseres Aufenthalts pras-selte der Regen auf die Kunststoffplanen, aber wir stiegen doch trockenen Fußes ab. Wir besichtigten noch eine kleinere ähnliche Anlage, aber da war ich nicht mehr „geistig auf Empfang gestellt“.
Dienstag, 6.4. – Plovdiv - Batschkovo-Kloster
Plevna, Plovdiv. Wiederum kommen die Erinnerungen. Hier verteidigte „der Löwe von Plevna“, der Pascha Ali, die Festung gegen die Türken, was ihn zum Helden ungezählter ungarischer Jugendbücher werden ließ. Derselbe „Held“ bekam von ei-ner zu diesem Zweck extra nach Istambul (hier soll man wohl Istambul sagen) ge-reisten ungarischen Studentendelegation einen Ehrensäbel überreicht, was die so-wieso gespannten österreichisch-russischen Beziehungen noch mehr verschlechter-te. Er kommt auch in Dostojewskijs „Tagebuch eines Schriftstellers“ als wahres Un-geheuer vor. Übrigens, hätte er ein bisschen länger ausgehalten, hätte er die Welt-geschichte verändert. Selbst gemäßigte Kreise in Russland forderten angesichts der langen Erfolglosigkeit die Einberufung einer verfassungsgebenden Nationalver-sammlung. (Ist es Euch nicht aufgefallen, dass verlorene Kriege dem russischen Volk mehr nutzten als gewonnene? Nach dem Krimkrieg kamen die alexandrini-schen Reformen, nach der Niederlage gegen Japan die erste Verfassung, nach dem verlorenen I. Weltkrieg die bürgerlich-demokratische Revolution, die aber leider bald von der kommunistischen Diktatur abgelöst wurde, nach dem Sieg über Napoleon herrschte der Reaktionär Araktschajew, und die „Heilige Allianz“ wurde geschlossen, nach dem II. Weltkrieg kam der Spätstalinismus.)
Nun aber genug abgeschweift, jetzt sind wir in Plovdiv. Die Stadt ist eine lebhafte Industriestadt mit arbeitenden Fabriken (das ist keinesfalls selbstverständlich, denkt an die Fabrikruinen in Armenien oder Rumänien). Wir fuhren bei „durchwachsenem“ Wetter durch eine herrliche von einem Flüsschen gesäumten Landschaft.

Unser Ziel war das Batschkovo-Kloster. Es wurde 1083 von zwei adligen Brüdern aus Georgien (!) gegründet, entwickelte sich rasch zum kulturellen und religiösen Zentrum, überlebte relativ unbeschadet und privile-giert die osmanische Herrschaft, und man baute es in der Renaissancezeit sogar weiter aus (Dieser Begriff ist zuerst politisch gedacht, so bezeichnet man die Zeit nach der Wiedererlangung der Unab-hängigkeit. Aber man überträgt es auch als Stil-merkmal auf die Bauten und Kunstwerke, die zu die-ser Zeit entstanden sind.). Vor dem Kloster gibt es zahlreiche Verkaufsstände mit Andenken und Le-bensmitteln, wie an allen ähnlichen Orten in der ganzen Welt. Wir hatten Glück (oder eine kluge Vorbereitung). Viele Stände waren geschlossen, es gab relativ wenige Besucher (vielleicht lag es auch ein bisschen am Wetter). So ist die jüngste Kirche, die Erzengel-Kirche, ein Werk der „bulgarischen Renaissance“. Die Heiligenbilder enthalten moderne soziale und politische Anspie-lungen z. B. das Bild „der Reiche und der kranke Lazarus“. Viel wichtiger ist die „Hei-lige Gottesmutterkirche“ aus dem XVII. Jh., ein mächtiger Kuppelbau, für eine ortho-doxe Kirche gut durchleuchtet. Dort steht im reichverzierten Silberrahmen die hoch-verehrte Marien-Ikone, die am zweiten Ostertag feierlich in die in der Nähe gelegene Erzengel-Kathedrale getragen wird, wo ein Gottesdienst stattfindet. Dies geschah am Vorabend unseres Besuches in Anwesenheit zahlreicher Pilger, was bewirkte, dass am Tag, wo wir da waren, alles ziemlich ruhig war und besichtigt werde konnte.
Das mit den Ikonen ist „so 'ne Sache“, laut Beschluss des Konzils von 843 dürfen sie nur verehrt, aber nicht angebetet werden. Aber erkläre mal den Unterscheid ei-nem einfachen Gläubigen aus dem Volk. Denkt an die herrliche Szene aus dem „Krieg und Frieden“ von Tolstoj, wo die Prinzessin Maria (die spätere Frau Rostow) sich mit ihren „Betschwestern“ „aus dem Volk“ trifft und sich mit ihnen über Pilger-fahrten und „wundertätige Ikonen“ unterhält, zur Erheiterung ihres Vaters, der es mit den französischen Aufklärern aus dem XVIII. Jh. hält. Die Kirche ist auch sonst überall bemalt, nettes Detail: die bösen Heiden tragen türkische Krummsäbel.
Den absoluten Höhepunkt der bulgarischen Malerei stellen aber die Wandmalereien im Refektorium (Speisesaal) dar, sie sind nur mit der Wandmalerei an der Wand der Petrus-und-Paulus-Kirche in Veliko Tarnovo vergleichbar. Nur, dort ist westlicher Einfluss spürbar, hier ist alles orthodox, ja, wie unser Führer sagte, sie ist eine bildli-che Zusammenfassung der orthodoxen Lehre, eine Art „biblia pauperum“ (sehr ge-naue bildliche Darstellung religiösen Inhalts für Analphabeten) und gleichzeitig eine Belehrung darüber, was vom klassischen Altertum in der östlichen Tradition übrig geblieben ist.
So sieht man: den Stammbaum Jesu Christi, die acht von Orthodoxen wie von Ka-tholiken anerkannten Konzilien, die Apostel, die Evangelisten, die Propheten, dann aber Persönlichkeiten des Altertums: zuerst die Philosophen, erkennbar an Schriftrollen in den Händen und an Kronen auf den Häuptern (aber natürlich ohne Heiligenschein), in reiche Ge-wänder gekleidet. Neben Aristoteles und Sokra-tes, die dazugehören, taucht hier der spitze und recht freizüngige Komödiendichter Aristhopha-nes und ein einfach gekleideter Kleomanes, „ein Mann aus dem Volke“ also, der gibt einem Rätsel auf. Ist das etwa Kleon (?- 422. v Ch.), ein athenischer Radikaldemokrat aus dem V. Jh., ein Gegner Spartas, eine Art antiker Robespierre, oder Kleomenes III. (254- 219. v. Ch.), König von Sparta, der auch nicht ganz ohne war, zuerst vergiftete er einen Nebenkönig (in Sparta regierten immer zwei Könige nebeneinander und kontrollierten sich gegenseitig), brachte die fünf Ephoren (hohe Beamte, die eine Art Oberaufseherfunktion ausüb-ten) um und führte große Reformen zugunsten des einfachen Volkes gegen die Aris-tokratie der „Altspartiaten“ ein. Insofern war er tatsächlich ein „Mann des Volkes“. Er endete durch Selbstmord. Sein „Glück“ war, dass der im Mittelalter hochgeachtete Plutarch seine Biographie verfasste und er dadurch im kollektiven Gedächtnis blieb. Außerdem sieht man noch Diogenes, Perikles, den schon erwähnten Geschichts-schreiber Plutarch, den römischen Arzt Galenus, eine in bulgarischen bildlichen Dar-stellungen - außer Heiligen und Herrscherinnen - seltene Frauendarstellung der Se-herin Sibylle12 und ein geheimnisvoller Okiaros, über den ich trotz Internet nichts herausfand (kann mir jemand helfen?). Der Baedeker irrt sich, wenn er diese Dar-stellungen als selten einstuft. Wir haben ähnliche in Rumänien gesehen. Es fragt sich nur, wer wen beeinflusste. Beeindruckend ist auch eine Darstellung des jüngs-ten Gerichts mit nackten Frauen (!) und einem Selbstbildnis des Künstlers. Das Schönste war, zumindest für mich persönlich, ein Marienantlitz am Tor des „Bein-hauses“. Ja, hier kann man vom „Antlitz“ reden. Natürlich gib es ein vorgegebenes Muster, schmales Gesicht, lange gerade Nase. Aber was hat der Künstler daraus gemacht? Welcher edle Ausdruck, welche Schönheit, wie bei einem Meisterwerk von Giotto. So etwas hat man für immer vor den geistigen Augen.
Nach diesem eindrucksvollen Besuch wandten wir uns prosaischeren Dingen zu (man verzeihe den etwas zu prompten Übergang). Ein sehr gutes Mittagessen im Hotel, und dann auf zur Eroberung von Plovdiv. Es war eine nasse Eroberung. Aber, als wir buchstäblich im Regen vor dem Schaufenster eines kleinen Ladens standen, kam der Inhaber desselben und bot uns Billigschirme an. So bewaffnet, konnte man ja erobern. Wir sahen schöne Häuser im bulgarischen Renaissance-Stil und besuch-ten das ethnographische Museum (da war es wenigstens trocken). Das Haus an sich ist schon sehenswert, weil es sich den Gegebenheiten des Terrains anpasst (von verschiedenen Straßen aus, in verschiedenen Stockwerken). Im Inneren fesselt ein großes Gemälde „Jahrmarkt in Plovdiv“, entstanden in der Zeit, als Plovdiv zum halbabhängigen Fürstentum Ostrumelien gehörte. Auch darüber erfuhren wir einige interessante Details. Jeder Bewohner des Fürstentums benötigte - wenn er ins „ande-re Bulgarien“ wollte, einen dreisprachigen (bulgarisch-türkisch-französischen) Reise-pass. Nach so vielen Bildern religiösen Inhalts war es ein wahres Labsal (Verzeihung, M. H.), etwas Weltliches zu betrachten. Desto mehr, weil das Gemälde wirklich schön und instruktiv ist. Man befindet sich mitten im Geschehen. Ein Pope schreitet würdevoll durch die Menge, eine vornehme westlich gekleidete Dame lässt sich dazu herab, den Markt zu besuchen, aber in erster Linie doch Bauern und Händler in Volkstracht. Man spürte schon den Anfang des Sozialen (in erster Linie durch die Frauengestalt), aber eben nur den Anfang. Dies zeigt sich in der ganzen Ausstellung. Handwerk wandelte sich allmählich in In-dustrie, Wohnungseinrichtungen und Kleidermoden wurden westlicher (zumindest bei den Wohlhabenden), aber das bäuerliche und das Hirtenleben blieben noch weitgehend archaisch.
12 In den Sibyllinischen Büchern erkannten die Christen einen Hinweis auf Christi Erscheinen (G. Weis).

Wie alles Römische imponiert das wohl stark restaurierte Theater, (mit Aufführungen bei wohl besserem Wet-ter), in der Konstantin-und-Helena-Kirche gibt es Iko-nen, eine große, heute noch benutzte Moschee (in Bulgarien gibt es eine star-ke sowohl türkisch als bul-garisch sprechende islami-sche Minderheit) befindet sich neben nicht uninteressanten römischen Ausgrabun-gen, (die noch weitergeführt werden). Schließlich gibt es zwei Gedenktafeln mit Be-zug auf Frankreich: Im XIX. Jh. hielt sich der französische Dichter und Politiker La-martine (1848 war er sogar Außenminister und verfasste in diesem Revolutionsjahr eine leidenschaftliche Verteidigungsschrift für die Trikolore und gegen die rote Fah-ne, die viele als Symbol der Revolution als Nationalfahne einführen wollten.) in der Stadt auf. An der gleichen Stelle hielt 1988 der französische Staatspräsident Mitte-rand eine Rede, in der er das Ende des „Ostblocks“ sozusagen „voraussagte“.
Mittwoch, 7. 4. – Borowetz - Rila-Kloster
Jetzt ging es wieder nordwärts, in das Rila-Gebirge. Die Landschaft wurde immer winterlicher, auf einmal lag überall Schnee, und wir waren am Wintersportort Borowetz. Unser Führer, der, wie er andeutete, nicht sehr gern, aber dort auch tätig war, erzählte viel davon. Vor der Wende war der Ort ein Skiparadies - auch für (West-) Deutsche. Die Preise waren günstig, die gute Ausrüstung samt Kursen billig zu mie-ten, die Leute fühlten sich wohl. Mit der Wende kamen andere Zeiten. Es sei zwar immer noch alles billig, aber die Qualität der Ausrüstung, die Verpflegung und alles andere habe sich verschlechtert. So bleiben die deutsche Gäste aus, nur Gäste aus nordwesteuropäischen Ländern, die an billigen alkoholischen Getränken interessiert seien, kämen in großer Zahl. Deren geräuschvolle Heimkehr zu morgendlicher Stun-de verschrecke aber die wirklichen, noch müden Wintersportler. Wir hielten für kurze Zeit vor einem in Treppenform erbauten (die in den achtziger Jahren modern war) großen Hotelgebäude, das von außen keinen schlechten Eindruck machte. Die Bar am oberen Stockwerk sah auch nicht etwa ungepflegt aus. Am Hang, direkt vor dem Gebäude, wurde fleißig Ski gelaufen. Wir waren aber eine kulturell-religiöse Gruppe (es muss auch solche widerliche Snobs geben) und mehr am Rila-Kloster interes-siert. Davor aber konnten wir eine herrliche Berglandschaft und eine vorzügliche Fo-rellenmahlzeit genießen.

Das Rila-Kloster wurde im X. Jh. zu Ehren des heilig gesprochenen Mönches Iwan Rilski gegründet, der heute dort begraben liegt. Die unweit gelegene Höhle, wo er als Einsiedler gelebt hat, gilt heute auch als heiliger Ort. Auch wenn sich sein Grab heute im Kloster befindet, ist bei diesem Heiligen der Ausdruck „ewige Ruhestätte“ fehl am Platz. Kurz nach seinem Tod überführte der Zar seine Gebeine nach Sredez, der damaligen Hauptstadt. 1183 ließ der ungarische König Béla die sterblichen Überreste nach Gran (ung. Esztergom) bringen. Bald danach überführte man sie feierlich nach Tarnowo, in die neue Hauptstadt. Während der Türkenherrschaft 1469 fanden sie unter großer Beteiligung der Bevölkerung eine - hoffentlich letzte - Ruhe-stätte im Kloster, das schon im Mittelalter von Zaren gefördert, als geistiger Mittel-punkt galt. Später übernahmen türkische Sultane die Rolle des Beschützers. Sie konnten die Abtei weder davor schützen, im XV. Jh. von Räuberbanden und 1833 von einem verheerenden Brand zerstört zu werden. Beide Male wurde alles wiederaufgebaut, so dass wegen des Brandes der Hauptteil der Gebäude aus dem XIX. Jh. stammt. 1834 riss man die mittelalterliche Kirche ab, (eine Barbarei, aber denkt daran, dass man in Mittelalter auch in Westeuropa romanische Kirchen abriss und gotische bau-te, wenn man Geld dafür hatte) und ersetzte sie durch einen Neubau, der laut Buch byzantinische und barocke Merkmale trägt. Die jetzigen vier Gebäudeflügel bilden ein imposantes geschlossenes Viereck, in dessen Mittelpunkt der 700 Jahre alte Chreljo-Turm, benannt nach dem Klostergründer (Näheres s.u.), sowie die Kloster-kirche stehen. Wir gingen zuerst ins Klostermuseum. Es befindet sich im neu aufge-bauten Südostflügel, und zwar im Erdgeschoss und im Keller. Unser Führer erzählte, dass er vor dem Einbau der Heizung mit „seinen Touristen oft tüchtig gefroren habe“.
Tja, zum Kunstgenuss gehört Wohlbefinden. Wir befanden uns aber wohl, und wir sahen, wie immer, viel Interessantes. Als wichtigsten Eindruck nahmen wir mit, dass dieses Kloster auch in den finstersten Zeiten der politischen türkischen und geisti-gen griechischen Unterdrückung ein Hort des Bulgarentums, ja des Slawentums schlechthin gewesen ist. Wie schon erwähnt, wurde das Kloster vom Fürsten Hjelko Dragowol gegründet, eine zweitrangige Persönlichkeit, die vom Zerfall des bulgari-schen Reiches profitierte, unterstützt vom ebenso zwielichtigen, mehrmals ein- und abgesetzten, einen blutigen Bürgerkrieg verursachenden byzantinischen Kaiser Jo-hannes Kantakuzenos, und das angesichts der jährlich wachsenden osmanischen Macht. Trotzdem steht sein Grabstein am Anfang der Sammlung nebst einer In-schrift, die über seinen Tod berichtet. Ebenso aus dieser Zeit stammen eine ge-schnitzte Altartür und ein ebenso geschnitzter Bischofsstuhl. Eine Seltenheit sind Handschriften in glagolischer Schrift (s.o.), das Vermächtnis des Heiligen und seine „Vita“, allerdings als Kopien aus dem XV. Jh. Aufbewahrt werden auch die Urkunden der türkischen Sultane, die aber das Kloster nicht von der Zerstörung haben bewahren können. Auf-fallend sind die Zeugnisse über die Kontakte zu Russland. Gesandtschaften gingen hin und her, wunderbare Handschriften mit prächtigen silbernen wechselten den Besitzer. Natürlich enthält die Sammlung auch zahlreiche sakrale Gegenstände, Messgewänder, goldene und silberne Kelche, Kru-zifixe etc. Interessant ist auch der Beginn der kul-turellen Tätigkeit. Der Mönch Neofit Rilski verfass-te im XVIII. Jh. eine bulgarische Geschichte, in der er „die unwissenden Bulgaren“ auf ihre glorreiche Vergangenheit, und damit wohl, wenn auch unausgesprochen, auf die traurige Gegenwart aufmerksam machte. Da-mit begann eine intensive Schultätigkeit, von der Lehrbücher (auch weltliche, z. B. über Mathematik und Sprachen), Schulordnungen etc. Zeugnis ablegen. In Bulgarien und in Polen ging „die nationale Erweckungsbewegung“ eng mit den Nationalkirchen zusammen, in Ungarn war die katholische Kirche natürlich habsburgertreu, dort hatte jene eine antiklerikale, nicht eine antireligiöse Seite. Da die Kirche halb im Barockstil gebaut ist, ist sie heller als die meisten orthodoxen Kirchen. Der Hauptschatz ist eine reichverzierte Holzkiste mit den Reliquien des Namenspatrons.
Die Hauptsehenswürdigkeit des Klosters ist natürlich die Klosterkirche. Der Innen-raum ist beherrscht von der großen Ikonenwand, die die größte auf der Balkanhalb-insel ist. Das Schönste an ihr sind die Holzschnitzereien, so plastisch, dass sie schon richtig als Reliefs wirken. Wie üblich, leuchtet das Ganze gerade vor Gold. Die Ikonen sind auch künstlerisch wertvoll. In den Seitenkapellen gibt es viele Bilder von Stiftern. Gesichter wie Kleidung sind sehr realistisch und vermitteln einen guten Ein-druck über das Aussehen der Menschen in jener Zeit. Am besten gefiel uns eine Bil-derserie, wo die Wandlung der heiligen Maria von Ägypten von einer Prostituierten zur Heiligen, unter dem Einfluss eines Eremiten, dargestellt wird. Vor Kurzem hat es eine britische Prinzessin, zumindest in den Augen der Öffentlichkeit, und ganz ohne Eremiten, auch geschafft.
Anders steht es mit den Bildern an den Außenwänden. In grellen Farben äußerst vereinfacht schildern sie Heiligengeschichten und Höllenqualen. Man fragt sich, wo die Kunst endgültig aufhört und der (religiöse) Kitsch beginnt. Ein nicht unwesentli-cher Teil der Anlage ist die Klosterküche, in der früher für Tausende von Pilgern (die drei Tage lang kostenlos versorgt wurden) gekocht werden musste. Beeindruckend ist der riesige Kamin.
Aber nach dem Besuch des Klosters waren wir mit dem Heiligen nicht ganz fertig. Der Ort seiner Zurückgezogenheit konnte und wollte besichtigt werden. Wer durch die enge Höhle hindurchkriecht, bekommt alle seine Sünden erlassen. Es führt ein Pfad dorthin, steil, unregelmäßig, bestehend auch aus großen Steinen, die als Stützen und Treppenstufen dienen. Da der Regen Boden und Steine auch noch glit-schig machte, war der Aufstieg mühsam. Ein Teil der Gruppe unternahm lieber einen Spaziergang auf geradem Wege. Was mich betrifft, schaffte ich zwar den Aufstieg, aber dann dachte ich an die Nationalhymne meiner alten Heimat, wo es sinngemäß heißt, dass dieses Volk schon so viel gelitten habe, dass es nicht nur für die Sünden der Vergangenheit, sondern auch für die der Zukunft schon gebüßt ha-be. „Na, wenn es dem so ist“, dachte ich mir und stieg ohne Höhlenbesuch wieder hinunter, schon damit durch meine Langsamkeit keine Verspätung entsteht. Der Rest war eine angenehme Busfahrt nach Sofia, wo wir unser altes schönes Hotel wiederfanden.
Donnerstag, 8.4. – Sofia

Zu einer M. H.-Reise gehört normalerweise das frühe Aufstehen, ein lieblos servier-tes, hastig heruntergeschlungenes Frühstück und schöne lange Schlangen am Flug-hafen. Diesmal war es nicht so! Ein schöner, ab-wechslungsreicher Vormittag erwartete uns in Sofia. Zuerst sahen wir die „Rotonde“, einen alten Platz mit römischen Ausgrabungen, Reste von Wasserleitun-gen, gut fundierte Grundmauern, man ist dabei, ein römisches Theater freizulegen, alles ist solide, schön und beeindruckend, wie überall und immer (zumin-dest für mich persönlich alten unverbesserlichen „Rö-„Römerfan“). Darin eine alte runde (daher der Name) ehemals heidnische Stätte, jetzt christliche Kirche. Wir traten noch nicht ein, sondern gingen langsam zur Kathedrale. Direkt gegenüber der „Rotunde“ dräut immer noch (dieses altmodische Verb ist immer noch zutreffend) das ehrfurchterregende Gebäu-de der kommunistischen Parteizentrale. Von hier aus hat man das Land jahrzehnte-lang regiert, oder besser gesagt, hier hatte man mit mehr oder weniger Erfolg die „Direktiven“ aus Moskau den bulgarischen Gegebenheiten anzupassen. Unterwegs sahen wir die goldene Statue der heiligen Sophie, des Stadtsymbols, die dort steht, wo früher Lenin dem Aufbau des Sozialismus zusah. Vor dem Präsidentenpalais gab es Wachablösung. Die Wache trug genau die gleichen malerischen Uniformen wie die bulgarischen Soldaten im schönen alten Film „Helden“, der ja im bulgarisch-serbischen Krieg von 1885 spielt. Fragt sich, wer von wem „abgekupfert“ hat? Am ehemaligen Dimitrovplatz stand früher sein Mausoleum. Es wurde abgerissen. Schade, eigentlich ist so etwas ein Geschichtsdenkmal. Außerdem war dieser die Komintern (von Moskau dirigierter Zusammenschluss aller kommunistischen Partei-en der Welt) führende und erste kommunistische Staatschef Bulgariens (Dimitrov) doch eine Persönlichkeit. Im Leipziger „Reichstagsbrandprozess“ widersprach er mutig dem als Zeugen geladenen Göring und wurde freigesprochen (damals war die Justiz noch nicht total „gleichgeschaltet“)13. Gegenüber das imposante Gebäude des ehemaligen Königsschlosses, heute Museum der bildenden Künste. Es lief gerade eine Sonderausstellung. Ich hätte gern gewusst, welche. Ebenso nicht ohne Interes-se sind eine kleine, sehr bunte sehr „russische“ Kirche und die massigen Gebäude der theologischen Fakultät und der Nationalbank (noch ohne „Euro-Krise“). Das Be-freiungsdenkmal zu Ehren der russischen Soldaten des Krieges von 1877-78 durfte natürlich stehen bleiben. Dann waren wir in der Kathedrale Sweta Nedelja, sogar beim Gottesdienst. Feierliche Atmosphäre, Ikonen, Kerzen. Mir ist ehrlich gesagt wenig im Gedächtnis haften geblieben. Nur die Tatsache, dass der Gottesdienst vor der Ikonenwand zelebriert wurde. M. H. widersprach. Kann von Euch jemand helfen?
Unser letzter Kirchenbesuch in Bulgarien galt der „Rotunde“, einem römischen Rundbau, der nacheinander als heidnischer Tempel, christliche Kirche, türkische Mo-schee und dann wieder als Kirche gedient hat und jetzt dem heiligen Georg geweiht ist. Man entdeckte dort fünf verschiedene Schichten von Wandmalereien, eine Schicht bilden auch islamische Arabesken. Der Füh-rer hat unsere Aufmerksamkeit auf ein Bild, einen Engel mit einem weißen Blatt darstel-lend, gelenkt. Ich habe es nicht entdecken können, hat jemand (verbotenerweise) foto-grafiert?
13 Göring kannte diese Rolle Dimitrovs nicht. (G. Weis)

Das „Sahnehäubchen“ unserer Reise war das Archäologische Museum (nicht mit dem Historischen zu verwechseln!). Es ist in der ehemaligen großen Moschee untergebracht, was dem Gebäude schon an sich Wür-de verleiht. Hier hatten wir eine junge, sehr elegant gekleidete Führerin (Wenn ich das bemerke, der zu Bedauern aller meiner weiblicher Be-kannten keine Ahnung von Frauengarderobe habe, muss sie schon sehr elegant gewesen sein). Aber sie hatte auch fundierte Kenntnisse, und so sahen wir zuerst steinzeitliche Idole, erste Zeichen des erwachenden religiösen Bewusstseins, thrako-romanische Altertümer, eine Hirschstatue, die Mo-saikdarstellung eines Pferderennens im Zirkus, einen eleganten Grabstein, dann aber Gold, zum letzen Male Gold. Kunstvoll gearbeitete Gefäße und Deckel, und dann und dann, die Originale, jawohl, die Originalgoldmaske aus dem Seuthos-Grab. Irgendwie war es eine tiefe Genugtuung, obwohl Original und Kopie voneinander für Laien überhaupt nicht zu unterscheiden sind.
Am Mittag Flughafen, herzlicher Abschied vom Führer, die gewohnte köstlich- üppi-ge Verpflegung der Lufthansa. Mir wurde ohne jede extra Bitte ein zweiter Becher Weißwein angeboten (tja, den Säufer erkennt man überall). Eine ruhige Busfahrt, diesmal mit funktionierendem Lautsprecher und mit Hoffnung auf ein Wiedersehen.
Fazit:
Wenn man von der Rumänienreise, die wegen der persönlichen Beziehungen von M. H. unvergleichbar war, und von der Syrienfahrt absieht, wo man zahlreiche ver-schiedene Kulturen (altorientalisch, hellenistisch, römisch, byzantinisch, islamisch, jüdisch- hellenistisch - Bilder mit griechischen Inschriften in der Synagoge - die eu-ropäisch-mittelalterliche Kultur der Kreuzfahrerstaaten) fand, war das die schönste und interessanteste Tour. Sportlich ausgedrückt: einmal Gold, einmal Silber, einmal Bronze (Achtung Subjektivität!). Gestanden hat sie unter drei Zeichen: Byzanz, Thraker, bulgarische „Wiedergeburt“. Auch wenn es das Land historisch nur zweimal kurz beherrschte, lebt hier Byzanz in Kirchen, Ikonen und Klöstern so weiter, sozu-sagen „in der Luft, die man atmet“, wie vielleicht nirgendwo sonst. In Griechenland ist es von der Antike überlagert, in der Westtürkei von Hellenismus und Islam. Viel-leicht war das alte Russland auch so wie Bulgarien. Einer der Helden von Anna Ka-renina sagt: „ Der Westen und wir müssen einsehen, dass wir die Erben von Byzanz sind.“ Aber dort waren die Byzantiner nie. Dann die Thraker. Dieses geheimnisvolle Volk der Goldschmiede, der Künstler, der Tempelbauer und der Reichsgründer. Und schließlich die Bulgaren. Nationale Wiedergeburt, Freiheitskampf, selbstbewusste „fin de siècle“-Bauten, zwei verlorene Kriege. In vielem erinnert es mich an Ungarn.
An alle, die die Geduld haben, dies zu lesen:
In meiner seligen Referendarzeit hat man uns den „Mut zur Lücke“ nahegelegt. Eins könnt Ihr mir nicht vorwerfen, dass ich besagten Mut nicht gehabt hätte. Hoffentlich gibt es zwischen klaffenden Lücken doch ein wenig Substanz. Auf jede Art von „feed back“ würde ich mich freuen, selbst, wenn es nur der Satz ist: „Pál, haben wir eigent-lich dasselbe Land gesehen?“
P.S. Zwei Empfehlungen: Wenn Ihr es auftreiben könnt, lest den Band 13 „Byzanz“ der „Fischer Weltgeschichte“ oder besucht die Ausstellung „Byzanz, Pracht und All-tag“ in Bonn (bis zum 13.6.).
Tschüss und auf Wiedersehen.
Euer Reisgenosse
Pál